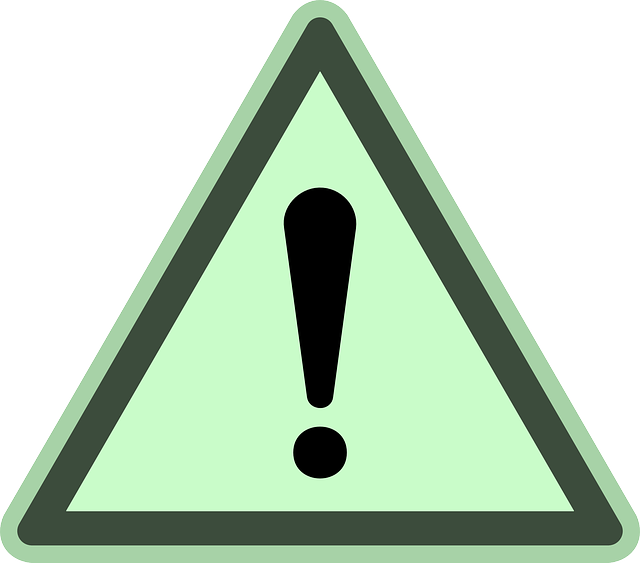Die Entscheidung von Meta, sein Faktenprüfungsprogramm einzustellen, hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Michael McConnell, Co-Vorsitzender des Meta-Oversight-Boards und Professor für Rechtswissenschaften an der Stanford University, kritisierte den Schritt scharf. Er erklärte, die Maßnahme wirke, als ob das Unternehmen „unter politischem Druck einknicke.“ Die Veränderungen wurden nur wenige Wochen vor der Amtseinführung von Präsident Donald Trump bekannt gegeben und nach einem Dinner von Meta-CEO Mark Zuckerberg mit Trump im Mar-a-Lago im November.
Hintergrund und Kritik
Das Faktenprüfungsprogramm von Meta wurde 2016 ins Leben gerufen, um der Verbreitung von Desinformationen durch ausländische Akteure – insbesondere Russland – entgegenzuwirken. Doch McConnell bemängelte, dass die jüngsten Änderungen in einer „hochpolitisierten Zeit“ vorgenommen wurden, was den Eindruck erwecke, dass Meta den
Forderungen der politischen Rechten nachgebe.
Mark Zuckerberg verteidigte die Entscheidung in einem Video, in dem er die Einführung von „Community Notes“ ankündigte – einer Funktion, die es den Nutzern ermöglichen soll, Inhalte selbst zu kommentieren und zu bewerten. Dies ähnelt dem Ansatz von Elon Musks Plattform X. Gleichzeitig überarbeitete Meta stillschweigend seine Richtlinien für Hassrede und entfernte explizite Verbote, etwa Inhalte, die Frauen als Objekte oder Transgender-Personen entmenschlichen.
Kontroversen und politische Implikationen
Zuckerberg argumentierte, dass das Faktenprüfungsprogramm „mehr Vertrauen zerstört als geschaffen“ habe. Es sei zunehmend dazu genutzt worden, Meinungen zu unterdrücken, was letztlich „zu weit gegangen“ sei. Laut McConnell sende die Änderung jedoch problematische Signale aus: „Die Optik ist schlecht. Es sieht definitiv so aus, als würde hier politischem Druck nachgegeben.“
Auch Metas neu ernannter Chief of Global Affairs, Joel Kaplan, bezeichnete das Faktenprüfungsprogramm als „gut gemeint, aber politisch voreingenommen“. Trump lobte die Entscheidung öffentlich und erklärte, Meta habe „einen langen Weg zurückgelegt“.
Ein globales Problem mit lokalen Spannungen
McConnell betonte, dass die Debatte um Faktenprüfung und Meinungsfreiheit vor allem in den USA stark polarisiert sei. In anderen Ländern seien solche Programme weniger umstritten. Er wies jedoch darauf hin, dass es „erdrückende Beweise“ dafür gebe, dass rechte Inhalte häufiger korrigiert würden. Ob dies daran liege, dass diese Inhalte tatsächlich mehr Desinformationen verbreiten, sei schwer messbar.
Die Entscheidung wirft Fragen zur Integrität künftiger Wahlen und zur Rolle sozialer Medien bei der Verbreitung von Regierungspropaganda auf. „Es gibt keine einfache Lösung für dieses Problem“, so McConnell. „Vieles hängt davon ab, wer die Informationen verbreitet und nicht nur davon, ob sie wahr oder falsch sind.“
Zukünftige Herausforderungen
Meta steht weiterhin vor der Herausforderung, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und der Verbreitung von Desinformationen zu finden. Während Kritiker die Abschaffung des Programms als Kapitulation vor politischem Druck werten, argumentieren Befürworter, dass „Community Notes“ eine demokratischere Lösung darstellen könnten. Die Frage bleibt jedoch, ob diese Maßnahme ausreicht, um die Integrität von Informationen auf den Plattformen zu gewährleisten – insbesondere in politisch sensiblen Zeiten.