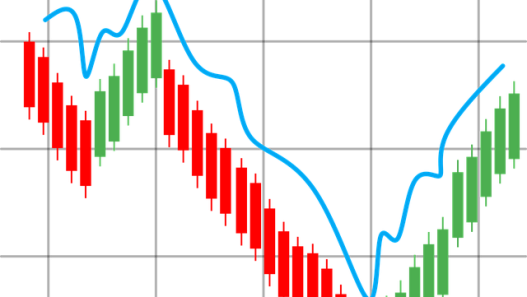Über Generationen hinweg lebte eine indigene Gemeinschaft auf einer kleinen Insel vor der Küste Panamas. Doch nun sind die meisten Bewohner fort – die ersten Klimaflüchtlinge des Landes.
Steigende Meeresspiegel bedrohen die Existenz der Insel, die laut Wissenschaftlern bis 2050 unbewohnbar sein wird. Die Regierung erklärte die Umsiedlung für notwendig, um die Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Doch nicht alle konnten oder wollten gehen.
Zwischen alter Heimat und ungewisser Zukunft
Rund 1.000 Menschen verließen im Juni 2024 ihre engen Holzhäuser und zogen in eine neue Siedlung auf dem Festland. Etwa 100 blieben zurück – einige, weil in der neuen Siedlung kein Platz mehr war, andere, weil sie den Umzug ablehnten.
Die leeren Straßen der Insel sind ungewohnt still. Wo einst Stimmen, Musik und Kinderlachen zu hören waren, sind nun nur noch das Rauschen der Wellen und das Quietschen der Boote am Steg geblieben.
Wer geblieben ist, will nicht nur die Nähe zum Meer bewahren, sondern auch die kulturellen Wurzeln der Gemeinschaft. Die Angst besteht, dass mit dem Verlust der Insel auch ein Stück Identität verloren geht.
Ein neues Zuhause mit Herausforderungen
Die neue Siedlung, nur 15 Minuten mit dem Boot entfernt, wirkt wie eine andere Welt: geordnete Straßen, identische Häuser mit kleinen Gärten, konstante Stromversorgung.
Hier gibt es Platz, um Obst und Gemüse anzubauen – ein Luxus, den es auf der überfüllten Insel nicht gab. Dennoch fühlen sich viele entwurzelt. Die Nähe zum Meer fehlt, die vertrauten Wege sind verschwunden, und nicht jeder kann sich an das Leben auf dem Festland gewöhnen.
Das neue Zuhause bietet mehr Sicherheit vor Naturgefahren, doch es gibt auch Herausforderungen:
- Die Wasserversorgung funktioniert nur stundenweise.
- Ein geplantes Krankenhaus wurde nie gebaut.
- Der Alltag ist anders, und die Umstellung fällt vielen schwer.
Trotzdem versucht die Gemeinschaft, sich einzuleben, ohne ihre Traditionen aufzugeben.
Der Kampf gegen das steigende Meer
Wissenschaftler warnen, dass es fast sicher ist, dass die meisten der übrigen Inseln des Archipels bis zum Ende des Jahrhunderts unter Wasser stehen werden.
Schon jetzt sind die Veränderungen spürbar:
- Fluten dringen regelmäßig in die Häuser ein.
- Böden sind dauerhaft feucht.
- Die steigenden Wasserstände machen das tägliche Leben immer schwieriger.
Obwohl die erste Umsiedlung wegen Überbevölkerung geplant wurde, zeigt sich nun, dass der Klimawandel die größere Bedrohung ist.
Kultur bewahren trotz Umsiedlung
Um ihre Identität zu erhalten, werden in der neuen Siedlung traditionelle Tänze, Musik und Handwerkskunst weitergegeben. In der modernen Schule lernen Kinder neben Mathe und Naturwissenschaften auch, wie man die bunten Stoffe fertigt, für die die Gemeinschaft bekannt ist.
Auch alte Bräuche werden beibehalten. Zeremonien, die früher auf der Insel stattfanden, werden nun im neuen Dorf abgehalten. Die Ältesten betonen, dass sich zwar die Umgebung geändert hat, nicht aber der Geist der Gemeinschaft.
Eine Lektion für die Welt
Die Umsiedlung dieser kleinen Inselgemeinschaft könnte ein Vorbild für viele andere werden. Experten gehen davon aus, dass hunderte Millionen Menschen weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts gezwungen sein werden, ihre Heimat wegen des Klimawandels zu verlassen.
Doch egal, wie weit sie gehen müssen – ihre Kultur, ihr Wissen und ihre Traditionen nehmen sie mit. Denn wahre Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern das, was eine Gemeinschaft zusammenhält.