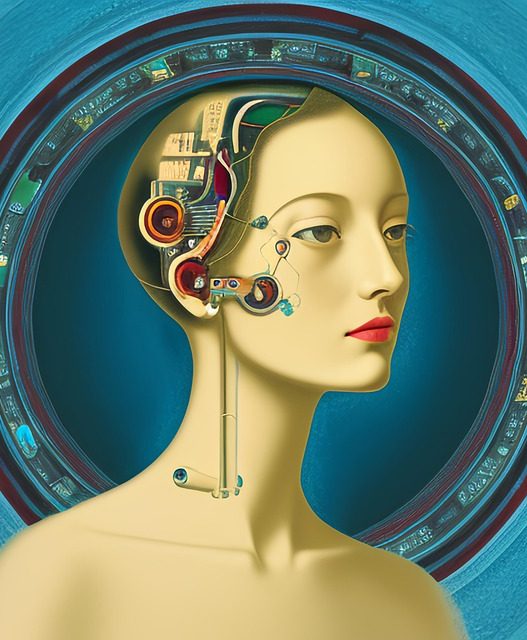Gestern Morgen stellte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2024 vor. Die Zahlen zeigen auf den ersten Blick eine erfreuliche Entwicklung: Die Gesamtzahl der Straftaten ist im Vergleich zu 2023 zurückgegangen. Doch hinter diesem Rückgang verbirgt sich ein komplexeres Bild – denn während bestimmte Deliktgruppen deutlich seltener registriert wurden, ist die Zahl der Gewaltdelikte spürbar gestiegen.
Ein Grund für die gesunkene Gesamtzahl der Straftaten ist die seit dem 1. April 2024 geltende Teillegalisierung von Cannabis. Durch die neue Gesetzeslage werden zahlreiche Verstöße, die früher als Straftat galten – etwa der Besitz kleiner Mengen für den Eigenbedarf – nun nicht mehr in die Kriminalstatistik aufgenommen. Das hat unweigerlich Auswirkungen auf die Fallzahlen. Kritiker warnen jedoch davor, diesen Effekt als echten Rückgang von Kriminalität zu interpretieren, da es sich teils um rein statistische Verschiebungen handelt.
Besorgniserregender ist hingegen die Entwicklung bei Gewaltdelikten, die im Jahr 2024 deutlich zugenommen haben. Laut vorab veröffentlichten Informationen aus dem Bundesinnenministerium sowie Recherchen des „Spiegels“ und der „Welt am Sonntag“ wurden insbesondere Körperverletzungsdelikte, gefährliche Eingriffe und Raubtaten häufiger registriert. Dies weckt Sorgen über die Sicherheitslage im öffentlichen Raum – auch wenn in vielen Fällen die Umstände der Taten (z. B. Beziehungsdelikte oder Alkohol-/Drogeneinfluss) noch näher analysiert werden müssen.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Zunahme jugendlicher Tatverdächtiger. Die Zahl minderjähriger Personen, die im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sozialforscher sehen hierin einen besorgniserregenden Trend, der mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen könnte – etwa dem Einfluss sozialer Medien, zunehmender Perspektivlosigkeit oder dem Mangel an präventiven Angeboten im schulischen und außerschulischen Bereich.
Auch die Debatte über den Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger flammt mit den aktuellen Zahlen erneut auf. Zwar wird hier oftmals pauschalisiert, doch Fachleute weisen darauf hin, dass bei dieser Statistik insbesondere auch der Aufenthaltsstatus, sozioökonomische Lage und das Alter differenziert betrachtet werden müssen. Fest steht: Die Diskussion über Integration und gesellschaftliche Teilhabe wird durch diese Zahlen weiter angeheizt.
Ein grundlegender Kritikpunkt an der PKS bleibt bestehen: Sie erfasst nur Tatverdächtige – also Personen, gegen die ein Anfangsverdacht besteht. Ob es später zu einer Anklage, einem Urteil oder gar einem Freispruch kommt, bleibt dabei außen vor. Die Kriminalstatistik gibt somit kein vollständiges Bild von tatsächlicher Kriminalität, sondern vielmehr von polizeilicher Ermittlungs- und Kontrollpraxis.
Innenministerin Faeser betonte bei der Vorstellung, dass die Statistik kein Grund zur Entwarnung sei. „Weniger Straftaten sind erfreulich, aber wir dürfen nicht übersehen, dass Gewaltbereitschaft und Jugendkriminalität zunehmen. Hier müssen wir mit präventiven Maßnahmen, Bildung und gezielter Unterstützung gegensteuern.“
Die vollständige Kriminalstatistik soll in den kommenden Tagen auch online zur Verfügung gestellt werden – inklusive detaillierter regionaler Aufschlüsselung. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab: Die Diskussion um innere Sicherheit, gesellschaftliche Veränderungen und den Umgang mit Jugendgewalt wird weitergehen – vielleicht intensiver denn je.