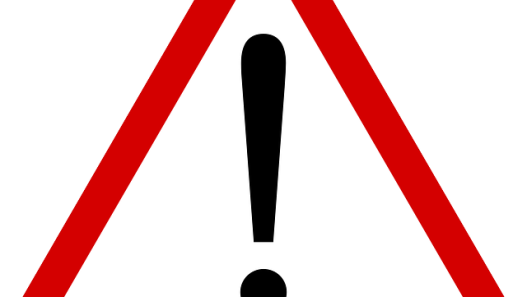Die „Neue Seidenstraße“, Chinas ambitioniertes Infrastrukturvorhaben, hat in den beteiligten über 150 Ländern nicht nur durch massive Investitionen in den Bau von Brücken, Häfen und Autobahnen Zeichen gesetzt, sondern auch eine Kette finanzieller Verpflichtungen geschaffen, die zu einer wachsenden Abhängigkeit von Peking führen könnten. Nach Angaben des US-Forschungsinstituts AidData hat China im ersten Jahrzehnt dieser Initiative Darlehen in einer Gesamthöhe von nahezu einer Billion Euro vergeben.
Mittlerweile ist bereits mehr als die Hälfte dieser Darlehen in die Rückzahlungsphase eingetreten, wodurch sich eine Schuldensumme – exklusive Zinsen – von mindestens 1,1 Billionen Dollar (etwa 1 Billion Euro) aufgebaut hat. Dieser Betrag lastet besonders auf den Schultern der Entwicklungsländer, die sich nun mit der Herausforderung konfrontiert sehen, diese Verbindlichkeiten zu managen.
China leistet jährlich Kreditzusagen von rund 80 Milliarden Dollar an Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, ein Volumen, das das der Vereinigten Staaten, welche ähnlich finanzschwache Staaten mit jährlich 60 Milliarden Dollar unterstützen, übersteigt. Infolgedessen hat sich Peking als weltweit größter Gläubiger von Staatsschulden etabliert, eine Rolle, die nach Einschätzung der Experten von AidData sowohl ungewöhnlich als auch unangenehm ist.
Obwohl Verfechter der „Neuen Seidenstraße“ auf das durch das Projekt generierte Wirtschaftswachstum im Globalen Süden hinweisen, wird das Vorhaben von Kritikern zunehmend hinterfragt. Sie weisen auf die Intransparenz in der Preisgestaltung bei Projekten chinesischer Firmen hin und erheben Bedenken hinsichtlich des enormen CO2-Fußabdrucks und der Umweltschäden. Vor diesem Hintergrund könnten die Schulden, die durch die „Neue Seidenstraße“ entstanden sind, zu einer doppelten Last werden – finanziell und ökologisch – und damit die Souveränität der beteiligten Länder unterminieren.