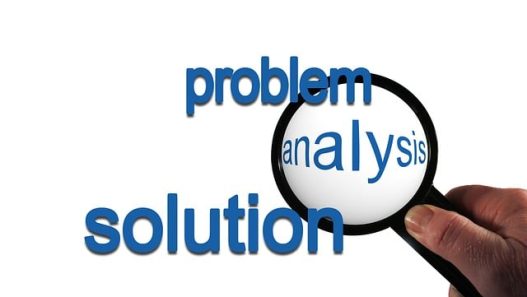Alle Versuche von CDU und CSU, die Verluste vor den Landtagswahlen am Sonntag zu begrenzen, haben nicht gefruchtet. Nach Masken- und Lobbyismusaffäre setzte es Verluste. Für das Superwahljahr bedeutet das eine Schwächung des Parteichefs Armin Laschet. Kanzlerin Angela Merkel geht mit Ende ihrer Amtszeit. Laschet muss nun bis September das Ruder herumreißen, doch auf den „Merkel-Bonus“ kann er nicht mehr bauen.
Wer auch immer in Merkels Fußstapfen tritt, wird es nicht leicht haben. Sie gab 2018 den CDU-Parteivorsitz ab und kündigte an, bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr zu kandidieren. Zum Zeitpunkt der Wahl im September wird sie 16 Jahre lang Kanzlerin gewesen sein. Und Merkel schaffte, was vielen ihrer Vorgänger verwehrt geblieben war: Sie wurde weder abgewählt noch durch innerparteiliche Grabenkämpfe demontiert.
Für ihre Nachfolge käme naturgemäß der neue Parteichef Laschet infrage. Er will sich aber noch nicht aus der Deckung wagen. Nach Ostern soll erst fixiert werden, wer für die Union aus CDU und CSU für die Kanzlerschaft kandidiert: Laschet oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der Schwesterpartei CSU. Das zögerliche Verhalten der Fraktionen lässt sich aus der Sorge vor eben jenen bekannten Grabenkämpfen erklären. Doch gerade daran wächst auch Kritik: Das Abwarten mit der heiklen Entscheidung signalisiert keine Stärke.
Gerade diese würde die Union aber jetzt brauchen: Am Sonntag erlitt sie bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz empfindliche Verluste und stürzte in beiden Ländern jeweils auf das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ab.
In Rheinland-Pfalz wurde die SPD unter Regierungschefin Malu Dreyer erneut stärkste Kraft. Sie will eine Fortsetzung der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. In Baden-Württemberg verteidigten die Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihre Spitzenposition. Kretschmann kann nun seine Koalition mit der CDU fortsetzen – muss er aber nicht. Die Grünen könnten theoretisch auch eine Ampelkoalition mit SPD und FDP eingehen.