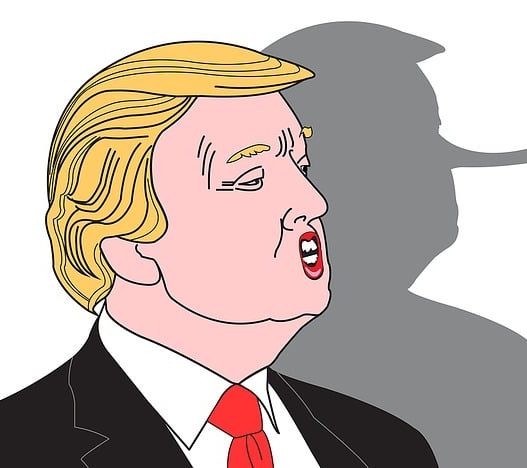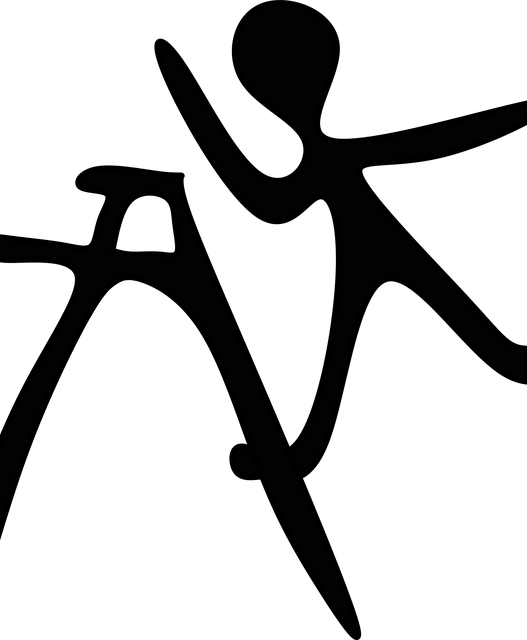Redaktion: Frau Bontschev, das Landeskriminalamt warnt aktuell vor einer besonders perfiden Betrugsmasche, bei der angeblich gestrandete Touristen auf offener Straße Bargeld erbetteln – angeblich mit sofortiger Rückzahlung per Banking-App. Wie schätzen Sie diese Masche juristisch ein?
Kerstin Bontschev: Aus juristischer Sicht handelt es sich hierbei um einen ganz klaren Betrug gemäß § 263 StGB. Die Täter täuschen eine akute Notlage vor – etwa einen Autodiebstahl oder verlorene Dokumente – um sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Die angeblich sofortige Rücküberweisung des geliehenen Bargelds über eine Banking-App ist eine weitere, gezielte Täuschung über Tatsachen. Es wird bewusst ein falscher Eindruck erweckt: dass eine Rückzahlung in Echtzeit erfolgt – obwohl sie in Wahrheit gar nicht beabsichtigt ist oder abgebrochen wird, sobald das Opfer sich abwendet.
Redaktion: Die Masche ist nicht neu – aber in dieser Version besonders hinterhältig. Wieso funktioniert sie dennoch?
Bontschev: Das liegt an der emotionalen Manipulation. Betrüger nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft und das soziale Gewissen ihrer Opfer. In der Psychologie spricht man hier von „emotionalem Hacking“ – und das ist genau, was hier passiert: Die Betrüger erzählen sehr glaubwürdige Geschichten, wirken höflich, gestresst, manchmal sogar panisch. Kombiniert mit einer gewissen „Internationalität“ – britischer oder irischer Akzent, gepflegtes Auftreten – entsteht beim Opfer der Eindruck: Dieser Mensch ist wirklich in Not – ich muss helfen. Und wer dann auch noch glaubt, dass das Geld ja sofort zurückkommt, senkt seine Schutzmechanismen. Das ist menschlich, aber genau darauf bauen die Täter.
Redaktion: Viele denken wohl: „Das waren halt ein paar hundert Euro – ich wollte doch nur helfen.“ Kann man in solchen Fällen rechtlich überhaupt etwas unternehmen?
Bontschev: Ja, auf jeden Fall! Auch wenn die Rückholung des Geldes oft schwierig ist, sollten Betroffene unbedingt Anzeige erstatten – und zwar sofort. Jede Anzeige hilft, Muster zu erkennen, Tätergruppen zu lokalisieren und womöglich auch Verbindungen zu anderen Fällen herzustellen. In vielen Fällen agieren solche Täter nämlich in Gruppen, teilweise mit festen Rollenverteilungen, was den Tatbestand des bandenmäßigen Betrugs erfüllt. Das kann zu deutlich höheren Strafen führen – bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
Redaktion: Das klingt schwerwiegend. Was würden Sie Bürgerinnen und Bürgern raten, um sich vor solcher Täuschung zu schützen?
Bontschev: Am wichtigsten ist: Behalten Sie Ihre Skepsis, auch wenn die Geschichte noch so plausibel klingt. Vertrauen Sie nicht blind darauf, was jemand auf einem Handybildschirm zeigt. Wer Geld überweist, soll dies bitte vorher tatsächlich auf dem eigenen Kontoeingang prüfen, bevor auch nur ein Euro Bargeld übergeben wird.
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seriöse Menschen, die wirklich in Not sind, werden Verständnis haben, wenn man helfen will – aber nicht kann, solange nichts sichtbar zurückgeflossen ist. Und ein ganz konkreter Tipp: Fragen Sie aktiv nach Hilfe über Polizei oder lokale Behörden, wenn jemand Ihnen eine Notlage schildert. Das schreckt viele Betrüger sofort ab.
Redaktion: Wie ist die Lage aus verfassungsrechtlicher oder strafprozessualer Sicht? Ist das strafrechtlich einfach zu fassen?
Bontschev: Betrug ist grundsätzlich gut erfassbar – aber die Beweislage ist in solchen Fällen oft dünn, weil es keine Verträge, keine schriftlichen Belege und häufig auch keine Zeugen gibt. Täter verwenden gefälschte Namen, temporäre E-Mail-Adressen und manchmal sogar gefälschte Banking-Apps. Deshalb ist es so wichtig, sofort zur Polizei zu gehen, möglichst genau zu beschreiben, wie die Person aussah, wie sie sprach, welches Fahrzeug genutzt wurde, welche Kleidung sie trug etc.
Es wäre auch wünschenswert, dass digitale Bezahlplattformen und Banken schneller reagieren, wenn sich herausstellt, dass eine App zur Täuschung oder Simulation einer Transaktion missbraucht wurde. Da müsste datenschutzrechtlich vielleicht ein besserer Weg gefunden werden, solchen Missbrauch schneller zu erkennen.
Redaktion: Gibt es Anzeichen, dass diese Masche gezielt auf bestimmte Zielgruppen ausgelegt ist?
Bontschev: Ja, das ist deutlich zu erkennen. Die Täter suchen oft ältere Menschen, Alleinreisende oder besonders empathisch wirkende Personen – also Menschen, bei denen sie eine hohe Chance vermuten, dass diese nicht sofort misstrauisch reagieren. Auch an Bahnhöfen, Flughäfen, Touristen-Hotspots oder rund um Banken und Geldautomaten wird häufig angesprochen. Es geht den Tätern um emotionalen Zugriff auf eine spontane Entscheidung, möglichst ohne Nachdenken. Das machen sie sehr gut – und genau deshalb ist Aufklärung so wichtig.
Redaktion: Letzte Frage, Frau Bontschev: Was macht man, wenn man bereits hereingefallen ist?
Bontschev: Wie gesagt: Sofort Anzeige erstatten, am besten direkt nach dem Vorfall bei der Polizei. Versuchen Sie, alles zu rekonstruieren, was Sie noch wissen – auch wenn es unwichtig erscheint. Falls Sie doch eine Bankverbindung oder einen Namen erhalten haben, lassen Sie das umgehend sperren. Und: Sprechen Sie mit Freunden oder Familie darüber. Viele schämen sich, hereingefallen zu sein – aber genau das nutzen Täter aus. Es gibt keinen Grund für Scham – nur für Wachsamkeit beim nächsten Mal.
Redaktion: Frau Bontschev, wir danken Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch.
Kerstin Bontschev: Ich danke Ihnen – und hoffe, dass möglichst viele Menschen durch solche Informationen gewarnt und geschützt werden.