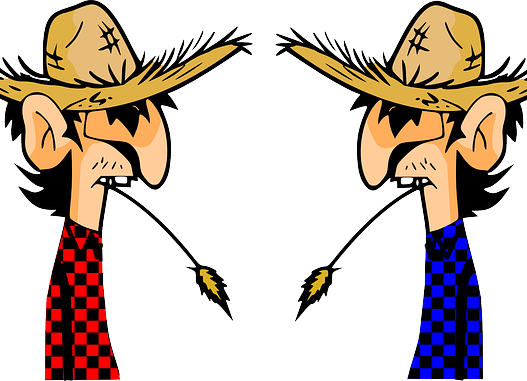Plastik ist überall – nicht nur in der Umwelt, sondern auch im menschlichen Körper. Forscherinnen und Forscher haben jetzt untersucht, wie viel Mikroplastik sich in verschiedenen Organen ansammelt. Besonders im Gehirn fanden sie große Mengen der winzigen Plastikteilchen.
Wie gelangt Mikroplastik in den Körper?
Mikroplastik besteht aus sehr kleinen Plastikstücken, die oft mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Sie können über die Luft, die Nahrung oder die Haut in den Körper gelangen. Experten schätzen, dass Menschen pro Woche bis zu fünf Gramm Mikroplastik aufnehmen – das entspricht ungefähr dem Gewicht einer Kreditkarte.
Neue Untersuchung zeigt: Gehirn besonders belastet
Ein Forschungsteam der University of New Mexico hat Gewebeproben von verstorbenen Menschen untersucht. Sie analysierten die Belastung von Leber, Nieren und Gehirn in den Jahren 2016 und 2024. Das Ergebnis:
- In Leber und Nieren lag die Belastung 2024 bei 433 Mikrogramm pro Gramm Gewebe – ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2016 (404 Mikrogramm).
- Im Gehirn war die Konzentration jedoch zehnmal so hoch: 2016 fanden sie dort 3.345 Mikrogramm pro Gramm, 2024 sogar 4.917 Mikrogramm.
- Damit hat sich die Menge an Mikroplastik im Gehirn in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Welche Folgen hat Mikroplastik im Körper?
Bisher wissen Forscher nicht genau, wie schädlich Mikroplastik für die Gesundheit ist. Erste Studien deuten darauf hin, dass es Entzündungen verursachen oder das Herz-Kreislauf-System beeinflussen könnte. Eine Untersuchung an Mäusen zeigte, dass Immunzellen die Plastikpartikel aufnehmen und dabei verklumpen können – das könnte Blutgefäße verstopfen und Thrombosen begünstigen.
Mikroplastik und Demenz?
Besonders auffällig war, dass die höchsten Mengen an Mikroplastik bei Menschen mit Demenz gefunden wurden. Ob Mikroplastik die Krankheit tatsächlich verursacht oder ob es nur eine zufällige Verbindung gibt, ist noch unklar. Die Wissenschaftler betonen, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um diese Frage zu beantworten.
Fazit
Mikroplastik ist im menschlichen Körper nachweisbar – und sammelt sich besonders im Gehirn an. Die Belastung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ob dies gesundheitliche Folgen hat, muss noch weiter erforscht werden. Wissenschaftler fordern deshalb mehr Studien, um die möglichen Risiken besser zu verstehen.