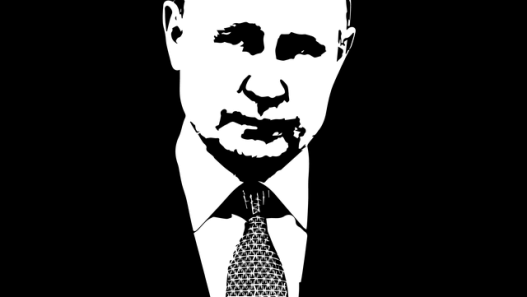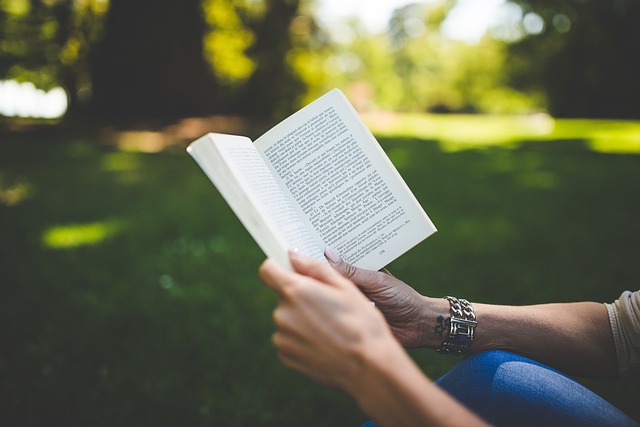Dulig: CO2-Strafzahlungen ab 2025 wären kontraproduktiv
Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig hat scharfe Kritik an den Plänen geäußert, CO2-Strafzahlungen für die Autoindustrie schon ab 2025 zu verhängen. In einem Interview mit dem MDR erklärte Dulig, dass er zwar die CO2-Ziele der EU unterstütze, jedoch die strikten Fristen in Frage stelle. „Es wäre Irrsinn, wenn die Autoindustrie im kommenden Jahr 15 Milliarden Euro an Strafzahlungen leisten müsste“, so Dulig. Er betonte, dass dieses Geld stattdessen in die Weiterentwicklung der Elektromobilität fließen sollte, um den Umstieg auf umweltfreundliche Technologien zu beschleunigen. „Die Automobilbranche braucht Zeit, um sich anzupassen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Strafzahlungen führen nur zu finanziellen Belastungen, ohne den gewünschten Effekt für das Klima zu erzielen.“ Die EU-Kommission hat bisher jedoch jegliche Vorschläge zur Lockerung der Grenzwerte strikt abgelehnt und hält an den bisherigen Vorgaben fest.
HUK-Studie: Nur wenige private Autokäufer entscheiden sich für E-Autos
Trotz der wachsenden Diskussion um Elektromobilität bleibt die Akzeptanz von Elektroautos unter privaten Autokäufern in Deutschland gering. Eine aktuelle Analyse des Versicherers HUK Coburg zeigt, dass im dritten Quartal 2024 weniger als vier Prozent der privaten Käufer ein Elektrofahrzeug wählten. Besonders auffällig: Ein Drittel der bisherigen E-Autofahrer hat sich in diesem Jahr erneut für einen Verbrenner entschieden, was Zweifel an der langfristigen Akzeptanz von E-Fahrzeugen aufkommen lässt. Laut der Analyse sind die meisten Elektroautos in Bayern unterwegs, wo der Anteil bei 3,4 Prozent liegt. In den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt hingegen bleibt der Anteil mit lediglich 1,5 Prozent äußerst gering. Die Ergebnisse zeigen, dass die Begeisterung für Elektromobilität, besonders unter Privatkunden, noch deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, was unter anderem auf Unsicherheiten bezüglich Ladeinfrastruktur und Reichweite zurückzuführen sein könnte.
Union will Bürgergeld reformieren, um Verteidigungsausgaben zu finanzieren
Angesichts steigender Verteidigungsausgaben hat die Union eine Reform des Bürgergeldes ins Gespräch gebracht. Der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, erklärte gegenüber dem MDR, dass die sogenannten „Mitnahmeeffekte“ beim Bürgergeld abgebaut werden müssten. Diese Einsparungen könnten dann in die Finanzierung der Bundeswehr fließen, um die steigenden Anforderungen an die Verteidigung zu bewältigen. „Wir müssen sehen, wo wir effizienter werden können, und das Bürgergeld ist ein Punkt, den wir auf den Prüfstand stellen sollten“, so Hardt. SPD-Haushaltsexperte Andreas Schwarz widersprach dieser Auffassung und forderte, dass nicht nur das Bürgergeld, sondern alle Ausgaben des Haushalts auf ihre Notwendigkeit geprüft werden müssten. Zudem plädierte er dafür, stärker gegen Steuerhinterziehung vorzugehen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Der Vorschlag der Union zeigt, dass die Debatte um die Finanzierung der Bundeswehr weiter an Brisanz gewinnt, besonders in Zeiten erhöhter sicherheitspolitischer Spannungen.
EU-Agentur fordert Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung
Angesichts alarmierender Zahlen zur Qualität der Gewässer in Europa hat die EU-Umweltagentur einen dringenden Appell an die Mitgliedsstaaten gerichtet, Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung zu ergreifen. Laut einem aktuellen Bericht der Behörde befanden sich 2021 nur 37 Prozent der Seen und Flüsse in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand – ein Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren. Trotz intensiver Bemühungen der Länder, die Qualität ihrer Gewässer zu verbessern, habe sich die Situation seit 2015 kaum verändert. Besonders die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die mit hohem Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden einhergeht, stelle eine erhebliche Belastung dar. Zudem werde der Klimawandel zu einer wachsenden Herausforderung für die Wasserversorgung, insbesondere durch Dürren und extreme Wetterereignisse. Die Agentur fordert daher verstärkte Anstrengungen, um eine nachhaltige Wassernutzung sicherzustellen und das Ökosystem der Gewässer zu schützen. Die Sicherung der Wasserversorgung sei entscheidend, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken und die Lebensgrundlage für künftige Generationen zu erhalten.