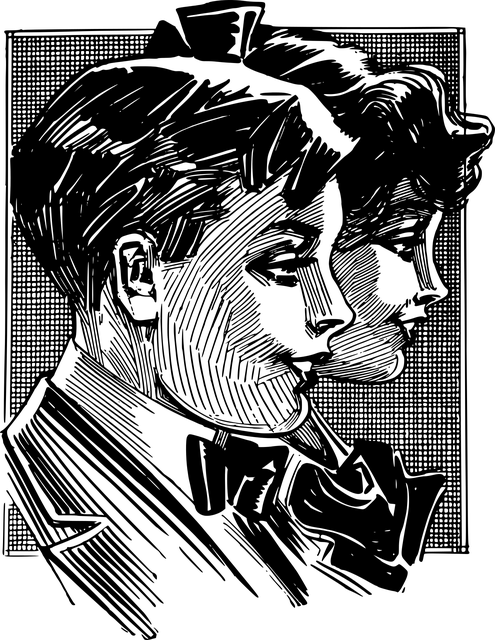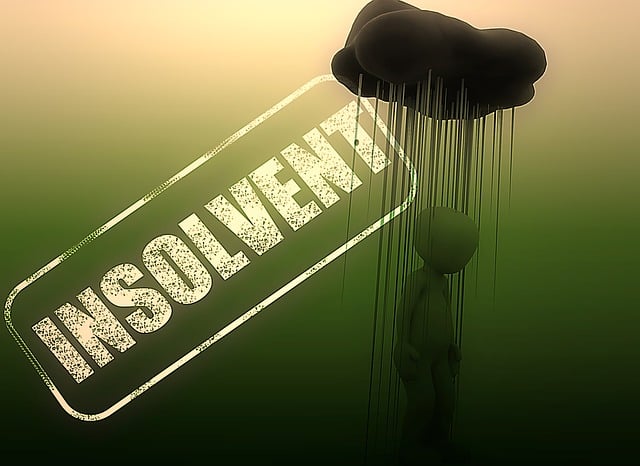Die jüngste Parlamentswahl in Österreich brachte ein überraschendes Ergebnis: Die rechtspopulistische FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) hat mit 29,2 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen. Damit setzte sie sich gegen die regierende ÖVP (Österreichische Volkspartei) durch, die erhebliche Verluste erlitt. Die ÖVP kam lediglich auf 26,5 Prozent, ein Einbruch von elf Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Der große Verlierer des Abends war also die konservative Partei des bisherigen Kanzlers Karl Nehammer, während die FPÖ unter Herbert Kickl einen beachtlichen Zuwachs von 13 Prozentpunkten verzeichnete.
Dieser Rechtsruck in Österreich wirft Fragen auf. Die FPÖ ist bekannt für ihre harten Positionen in Bezug auf Einwanderung, Sicherheit und europäische Integration. Ihr Erfolg bei der Wahl spiegelt die wachsende Unzufriedenheit vieler Österreicher mit der etablierten Politik wider. Besonders die Kritik an der Flüchtlingspolitik, die in Österreich wie in vielen anderen europäischen Ländern ein zentrales Wahlkampfthema war, hat der FPÖ Zulauf verschafft.
Auf europäischer Ebene könnte der Erfolg der FPÖ die politische Landschaft weiter polarisieren. Schon jetzt gibt es Befürchtungen, dass andere rechtspopulistische Bewegungen in Europa diesen Erfolg als Vorbild nehmen könnten. Eine Zusammenarbeit mit der EU könnte für die österreichische Regierung schwieriger werden, besonders wenn die FPÖ in eine Koalition eintreten sollte. Für Österreich selbst steht eine Phase intensiver Koalitionsverhandlungen bevor. Es ist noch unklar, ob es zu einer Zusammenarbeit zwischen der FPÖ und der ÖVP kommen wird oder ob andere Parteien mit in die Regierung eintreten.
Die Wahl stellt jedoch auch grundlegende Fragen zur Zukunft der liberalen Demokratie in Österreich. Kann das Land seine Position als stabiler europäischer Akteur bewahren, oder wird der Aufstieg der FPÖ zu einer noch stärkeren Polarisierung führen?