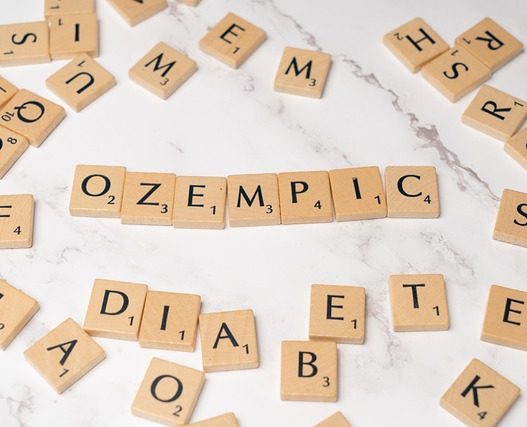Hybridfahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor nutzen, spielen auf dem deutschen Neuwagenmarkt weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Besonders Plug-in-Hybride (PHEV), die extern aufgeladen werden können, sind laut einer aktuellen Marktanalyse des Center Automotive Research (CAR) vor allem in den höheren Fahrzeugklassen zu finden. In der Kompakt- oder Kleinwagenklasse sind diese Modelle hingegen kaum vertreten.
Hohe Kosten und geringe Nachfrage bei Privatkunden
Ein wesentlicher Grund für die geringe Verbreitung von Plug-in-Hybriden liegt in den hohen Anschaffungskosten, die viele Privatkunden abschrecken. Während rein elektrische Fahrzeuge von zunehmender Modellvielfalt und sinkenden Batteriepreisen profitieren, bleibt die Doppeltechnologie der Plug-in-Hybride teuer in der Produktion. Diese Fahrzeuge werden daher überwiegend in der oberen Mittelklasse und der Oberklasse angeboten, wo sie vor allem als Firmenwagen und Dienstfahrzeuge genutzt werden.
Privatkunden hingegen entscheiden sich eher für vollelektrische Fahrzeuge oder klassische Verbrenner, da Plug-in-Hybride oft weder in puncto Reichweite noch in Bezug auf den Kosten-Nutzen-Faktor überzeugen. Auch der Wegfall staatlicher Förderprogramme für Plug-in-Hybride in Deutschland hat die Nachfrage weiter gedämpft.
Geringe CO₂-Einsparung in der Praxis
Ein weiteres Problem: Trotz ihres Potenzials zur CO₂-Reduktion leisten Plug-in-Hybride oft nur einen geringen Beitrag zur tatsächlichen Emissionsminderung. Studien zeigen, dass viele Nutzer diese Fahrzeuge im Alltag nur selten elektrisch aufladen und stattdessen überwiegend im Verbrennermodus fahren. Dies gilt insbesondere für Firmenwagen, bei denen Nutzer häufig keinen Anreiz haben, den Elektromodus konsequent zu nutzen.
CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer zieht daher eine kritische Bilanz: Trotz ihrer technologischen Vorteile bleiben Plug-in-Hybride eine Nischenlösung, die in der Praxis wenig zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes beiträgt. Die Hersteller konzentrieren sich zunehmend auf reine Elektroautos, während die Bedeutung von Hybridmodellen abnimmt.
Zukunftsperspektiven: Sinkende Relevanz von Plug-in-Hybriden
Während Hybridantriebe in der Vergangenheit als Übergangstechnologie zwischen Verbrenner und Elektrofahrzeug galten, könnten sie langfristig an Bedeutung verlieren. Viele Automobilhersteller setzen verstärkt auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und reduzieren das Angebot an Plug-in-Hybriden. Zudem dürften strengere EU-Abgasnormen und neue Flottenverbrauchsziele den Druck auf Hybridfahrzeuge weiter erhöhen.
Dennoch könnten Hybridfahrzeuge in bestimmten Anwendungsbereichen, beispielsweise für Langstreckenfahrer ohne ausreichende Ladeinfrastruktur, weiterhin eine Rolle spielen. Ob sie sich langfristig am Markt behaupten können, hängt maßgeblich von der Entwicklung der Ladeinfrastruktur, Batterietechnologie und staatlichen Regulierung ab.