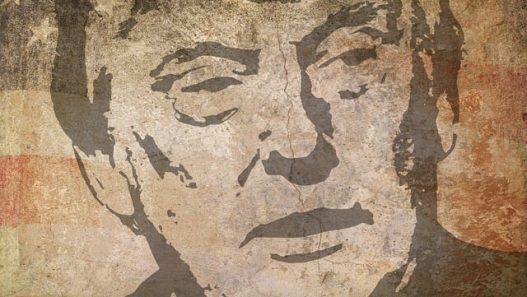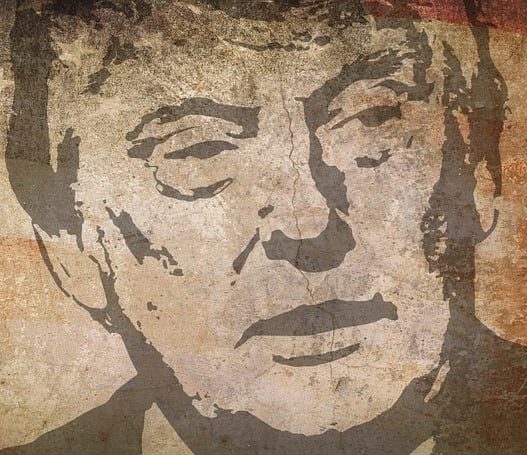Der Klimawandel hat viele Folgen – eine davon betrifft direkt die Gesundheit von Millionen: Die Zahl der Pollenallergiker steigt, die Symptome nehmen zu und die Pollensaison beginnt früher und dauert länger. Doch es gibt auch extreme Fälle, in denen Wetterereignisse wie Gewitter tödliche Asthmaanfälle auslösen können – ein Phänomen, das durch den Klimawandel begünstigt wird.
Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich 2016 in Melbourne, Australien. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich Tausende Menschen mit schweren Atemproblemen bei Notdiensten. Die Krankenhäuser waren überfüllt, Rettungswagen überfordert – zehn Menschen starben. Ursache war ein seltenes Phänomen: sogenanntes „Gewitterasthma“. Dabei werden Pollen durch starke Auf- und Abwinde in Gewittern in kleinste Partikel zerschmettert, die tief in die Atemwege eindringen und bei empfindlichen Menschen heftige allergische Reaktionen auslösen.
Obwohl solche Ereignisse bislang selten sind, warnen Experten, dass die Kombination aus häufigeren Unwettern und längeren Pollensaisons die Gefahr erhöht. Paul Beggs, Umweltgesundheitsforscher in Sydney, sagt: „Wir wissen, dass der Klimawandel mehr Pollen in die Atmosphäre bringt und die Pollensaison verändert.“
Frühere, längere und stärkere Pollensaisons
Durch die globale Erwärmung beginnt die Pollensaison in vielen Regionen früher und dauert länger – teilweise bis zu zwei Monate mehr pro Jahr. Das betrifft vor allem Nordamerika, Europa und Australien. Die wärmeren Winter, frühen Frühlinge und verzögerten Herbste verlängern die Zeitspanne, in der Pflanzen Pollen freisetzen.
Besonders problematisch ist die Ambrosia-Pflanze (Ragweed), deren Pollen bereits Millionen Menschen plagen. Sie wächst nicht nur auf Feldern, sondern auch in Städten. Eine einzige Pflanze kann bis zu eine Milliarde Pollenkörner freisetzen. Studien zeigen, dass Ambrosia-Saisons in Nordamerika in den letzten 20 Jahren deutlich länger geworden sind – in manchen Städten bis zu 25 Tage.
Mehr CO₂ = mehr Pollen
Ein weiterer Aspekt: Der steigende CO₂-Gehalt in der Atmosphäre beflügelt das Wachstum allergieauslösender Pflanzen. Experimente zeigen, dass etwa Ambrosia oder bestimmte Eichenarten bei höheren CO₂-Werten nicht nur schneller wachsen, sondern auch deutlich mehr – und oft aggressiver wirkende – Pollen produzieren.
In den USA stieg die Pollenmenge in der Luft seit den 1990er-Jahren um fast 50 %, während die Saison im Schnitt drei Tage früher begann. Solche Entwicklungen betreffen auch Europa: In Ungarn sind bis zu 60 % der Bevölkerung sensibilisiert gegenüber Ambrosia-Pollen, auch in Deutschland breitet sich die Pflanze weiter aus.
Was kann getan werden?
Einige Städte versuchen bereits gegenzusteuern. In Berlin etwa werden gezielt Ambrosia-Bestände entfernt. In der Schweiz ist der Verkauf der Pflanze seit 2024 verboten. Auch historisch gab es massive Maßnahmen: In den 1930ern engagierte Chicago Hunderte Arbeitslose, um Ambrosia auszurotten.
Neben der Bekämpfung der Pflanzen können auch Städte selbst Einfluss nehmen: Begrünung mit allergiearmen Pflanzen, Vermeidung sogenannter „botanischer Sexismus“ – also das bevorzugte Pflanzen männlicher, pollenreicher Bäume – und ein besseres Monitoring der Pollenbelastung könnten helfen. Derzeit gibt es nur wenige Dienste, die Allergene in der Luft präzise messen. Wissenschaftler fordern eine bessere Überwachung, da die Allergenmenge pro Pollenkorn wetterabhängig stark schwanken kann.
Fazit
Der Klimawandel macht Heuschnupfen nicht nur unangenehmer, sondern gefährlicher – und das weltweit. Ohne Gegenmaßnahmen drohen längere Leidenszeiten, mehr Betroffene und im Extremfall tödliche Zwischenfälle. „Wir haben die Daten, die zeigen, dass es echte Auswirkungen auf die Gesundheit hat“, warnt Beggs. Und das sei erst der Anfang.