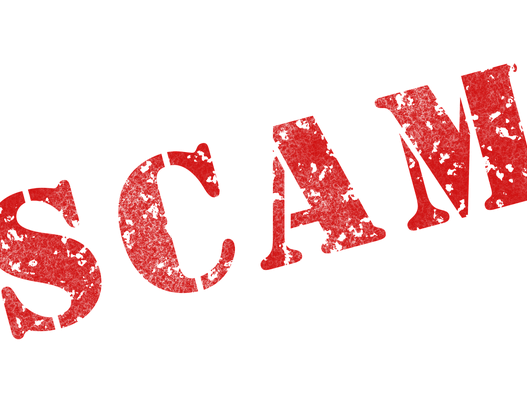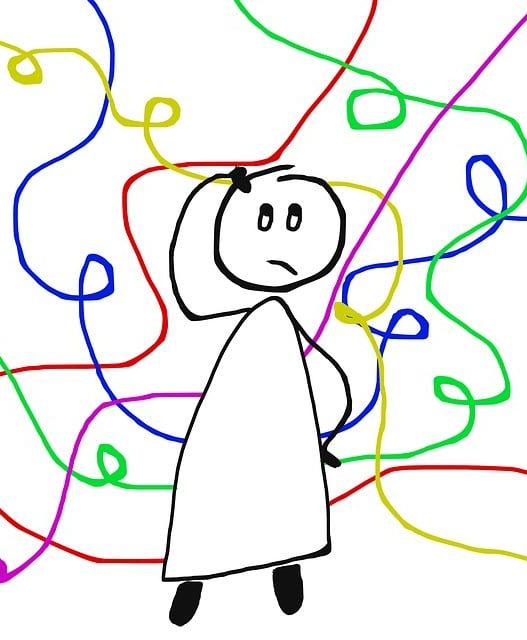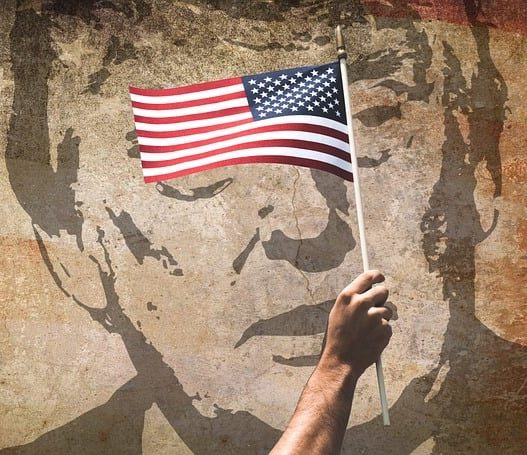Frage: Frau Bontschev, der rbb hat über einen besonders dreisten Fall von Sozialbetrug durch Scheinfirmen in Berlin berichtet. Wie bewerten Sie das?
Kerstin Bontschev: Solche Fälle sind leider keine Ausnahme mehr, sondern inzwischen weit verbreitet. Wir sprechen hier nicht von Einzelfällen, sondern von einem systematisch organisierten Vorgehen. Kriminelle Strukturen nutzen Strohmänner, fingierte Arbeitsverhältnisse und insolvente Firmenhüllen, um sich Zugang zu Sozialleistungen zu verschaffen – auf Kosten der Solidargemeinschaft.
Frage: Was macht dieses Vorgehen so effektiv – und so gefährlich?
Bontschev: Die Täter nutzen gezielt Lücken im Meldesystem der Sozialversicherung. Krankenkassen müssen sich zunächst auf die Angaben der Arbeitgeber verlassen. Eine Überprüfung der Arbeitsverhältnisse erfolgt in der Regel erst sehr spät – wenn überhaupt. Das öffnet kriminellen Netzwerken Tür und Tor, mit gefälschten Verträgen und falschen Angaben über Jahre hinweg Leistungen zu erschleichen.
Frage: Welche Rolle spielen dabei die sogenannten „Strohmänner“?
Bontschev: Strohmänner sind oft mittellose Menschen, häufig aus dem osteuropäischen Raum, die als Schein-Geschäftsführer eingesetzt werden. Sie haften formal für das Unternehmen, verschwinden aber nach kurzer Zeit. Die wahren Drahtzieher bleiben im Hintergrund – anonym, aber gut organisiert. So entziehen sie sich nicht nur der Haftung, sondern auch der strafrechtlichen Verfolgung.
Frage: Warum können solche Konstrukte über Jahre bestehen, ohne entdeckt zu werden?
Bontschev: Weil Kontrollmechanismen fehlen. Es gibt bislang keinen effektiven, automatisierten Datenaustausch zwischen Krankenkassen, Rentenversicherung und Arbeitsagenturen. Auffällige Muster – etwa plötzliche Gehaltssprünge, Mehrfachanmeldungen oder gleiche Kontodaten – werden zu spät oder gar nicht erkannt. Das ist ein enormes strukturelles Problem.
Frage: Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern?
Bontschev: Der Gesetzgeber muss den Sozialversicherungsträgern endlich die Möglichkeit geben, Informationen zu vernetzen und gezielt zu prüfen. Außerdem braucht es mehr personelle Ressourcen für Prüfungen vor Ort. Und: Notare und Handelsregister müssten genauer hinschauen, wenn plötzlich völlig unvorbereitete Personen Geschäftsführer von überschuldeten Firmen werden.
Frage: Was passiert mit den Tätern?
Bontschev: Wenn sie überhaupt identifiziert werden, drohen zivilrechtliche Forderungen und strafrechtliche Konsequenzen. Aber oft sind die Strohmänner längst verschwunden, und die Hintermänner kaum greifbar. Deshalb gilt: Prävention ist hier das stärkste Mittel – nicht nur Reaktion.