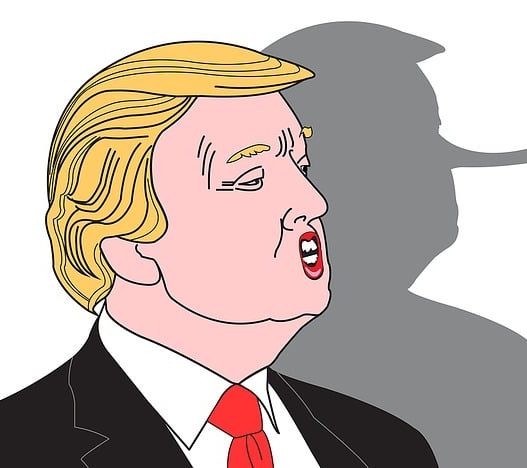Die überraschende Festnahme des ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte im März hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der 80-Jährige war wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit seinem brutalen Anti-Drogen-Krieg vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gesucht worden. Nun sitzt er in Haft in Den Haag, was viele internationale Beobachter als möglichen Wendepunkt im Umgang mit strafrechtlich verfolgten Spitzenpolitikern sehen.
Duterte hatte jahrelang den IStGH verspottet und dessen Autorität infrage gestellt. Umso überraschender kam seine Verhaftung, die auf einen geheim erlassenen Haftbefehl folgte und innerhalb weniger Stunden vollzogen wurde – ein Novum für das Gericht.
Signalwirkung für andere gesuchte Politiker
Die Festnahme sendet ein deutliches Signal: Niemand steht über dem Gesetz – auch nicht ehemalige Staatschefs. Internationale Juristen sprechen von einem wichtigen Präzedenzfall, der andere IStGH-Verfahren – etwa gegen Wladimir Putin oder Benjamin Netanjahu – beeinflussen könnte.
Beide Politiker sind vom IStGH gesucht:
- Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg, insbesondere der Deportation ukrainischer Kinder.
- Netanjahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza während des Konflikts mit der Hamas.
Allerdings stehen die Chancen auf ihre Festnahme derzeit schlecht: Russland erkennt den IStGH nicht an, und auch Israel weigert sich, dessen Zuständigkeit zu akzeptieren. Dennoch hat der Fall Duterte gezeigt, dass eine Festnahme nach dem Ausscheiden aus dem Amt durchaus möglich ist.
Politisches Kalkül oft entscheidend
Der IStGH ist auf die Kooperation seiner Mitgliedsstaaten angewiesen, da er keine eigene Polizeigewalt hat. So weigerte sich kürzlich Ungarn, Netanjahu festzunehmen, obwohl es als Vertragsstaat eigentlich dazu verpflichtet wäre. Stattdessen kündigte die ungarische Regierung an, den Austritt aus dem Gericht zu prüfen.
Die Kritik an doppelten Standards wächst: Während viele westliche Staaten den Haftbefehl gegen Putin unterstützten, distanzierten sie sich im Fall Netanjahu – ein Widerspruch, der laut Beobachtern die Glaubwürdigkeit des IStGH untergräbt.
Der lange Weg zur internationalen Gerechtigkeit
Seit seiner Gründung 2002 hat der IStGH 60 Haftbefehle erlassen – 31 Verdächtige sind noch auf freiem Fuß, nur 11 Personen wurden bisher verurteilt, allesamt aus afrikanischen Ländern. Experten hoffen, dass Dutertes Festnahme das Vertrauen in die internationale Strafjustiz stärkt und die „Kultur der Straflosigkeit“ allmählich zurückgedrängt wird.
„Es braucht oft einen Durchbruch, um Gerechtigkeit auf höchster Ebene möglich zu machen“, sagt Gregory Gordon, Experte für Völkerstrafrecht. Dutertes Fall könnte ein solcher Durchbruch sein – und ein Zeichen dafür, dass auch mächtige Akteure zur Rechenschaft gezogen werden können.