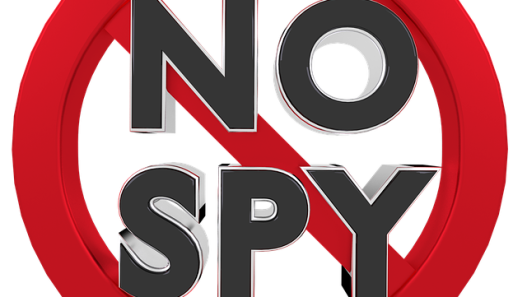Ungarn hat offiziell seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Diese Entscheidung wurde vom Stabschef des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Budapest bekannt gegeben – auffällig unmittelbar nach der Ankunft des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu einem bilateralen Besuch.
Der Zeitpunkt des Rückzugs wirft viele Fragen auf. Gegen Netanjahu liegt ein internationaler Haftbefehl des IStGH vor. Ihm werden mutmaßliche Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Militäreinsatz im Gazastreifen zur Last gelegt. Als Vertragsstaat des Rom-Statuts, der rechtlichen Grundlage des IStGH, wäre Ungarn bislang völkerrechtlich verpflichtet gewesen, Netanjahu bei Einreise zu verhaften und an das Gericht in Den Haag auszuliefern. Durch den Austritt entzieht sich die ungarische Regierung dieser Verpflichtung – eine politische Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen.
Offiziell begründet Budapest den Schritt mit dem Schutz der eigenen nationalen Souveränität und der Ablehnung „einseitiger, politisch motivierter Justizmaßnahmen internationaler Institutionen“. Es ist jedoch schwer, diese Entscheidung vom Kontext der aktuellen Entwicklungen zu trennen: Netanjahus Besuch in Ungarn, die internationale Diskussion über den Haftbefehl und die generelle Haltung der Orbán-Regierung gegenüber supranationalen Organisationen.
Kritiker sehen in dem Schritt einen weiteren Beweis für die Abkehr Ungarns vom westlich geprägten multilateralen Rechtsverständnis. Bereits in der Vergangenheit hatte die ungarische Regierung wiederholt betont, internationale Gremien sollten sich „nicht in nationale Angelegenheiten einmischen“.
Auch international bleibt die Entscheidung nicht folgenlos. Der Austritt Ungarns könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, vor allem für Länder, deren politische Führung in das Visier internationaler Justiz geraten ist. Sollte sich der Eindruck verfestigen, dass internationale Haftbefehle politisch motiviert und durch Austritte aushebelbar sind, könnte das die Autorität des IStGH weiter schwächen – ein Signal, das dem globalen Kampf gegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sicher nicht zuträglich ist.
Der IStGH reagierte bislang nicht offiziell auf die Entscheidung Ungarns. Völkerrechtsexperten erwarten jedoch eine Debatte über die künftige Rolle des Gerichts und die Verbindlichkeit internationaler Rechtsstandards – nicht nur in Europa, sondern weltweit.