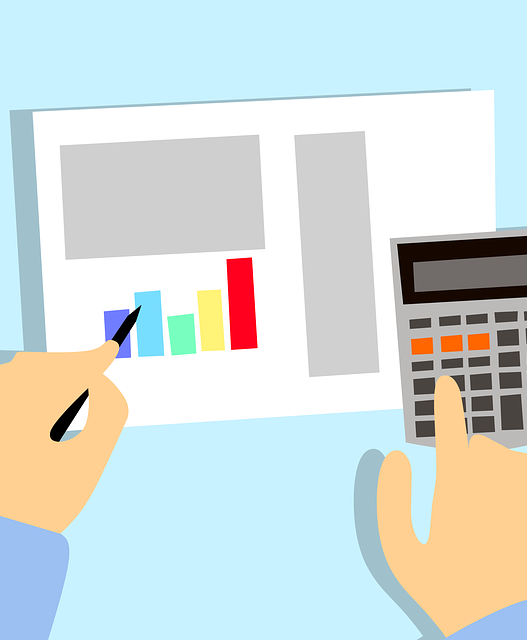Donald Trump liebt Superlative – vor allem, wenn es um seine eigenen politischen Pläne geht. Auch bei seiner umstrittenen Zollstrategie rund um den „Liberation Day“ am 2. April zeigt sich: Der frühere US-Präsident setzt nicht nur auf harte Maßnahmen, sondern vor allem auf geschickte Inszenierung. Statt mit klarer Linie überzeugt Trump durch ein altbewährtes Mittel aus dem Marketing: Ankündigen, was schlimmstenfalls passieren könnte – und dann etwas liefern, das zwar immer noch drastisch ist, aber vergleichsweise weniger schmerzhaft wirkt.
Drohen, dann relativieren
Was als flächendeckende Zolleskalation gegen alle US-Handelspartner angekündigt wurde, entpuppt sich nun als gestaffelte Maßnahme mit Ausnahmen: Autotarife? „Sehr bald“. Pharma? „Irgendwann“. Halbleiter und Holz? „Später“. Und bei den sogenannten „reziproken Zöllen“, also dem Prinzip: Wenn ihr uns besteuert, dann besteuern wir euch zurück, gibt es laut Trump sogar Spielraum für „Ausnahmen“.
Diese Strategie – Maximalforderung stellen, dann abschwächen – verfolgt Trump nicht zum ersten Mal. Bereits nach seiner Wiederwahl hatte er angekündigt, Kanada und Mexiko mit einem pauschalen 25-Prozent-Zoll auf sämtliche Waren zu belegen. Am Ende blieb es bei begrenzten Maßnahmen im Rahmen bestehender Handelsabkommen. Die Börsen reagierten prompt mit Erleichterung – ein kalkulierter Effekt?
Marketing statt Wirtschaftspolitik
Trump nutzt diese Strategie offenbar gezielt, um Stimmung zu machen: Einerseits gegenüber seiner politischen Basis, die ihm wirtschaftlichen Patriotismus abkauft. Andererseits gegenüber der Wirtschaft, der er durch das Zurückrudern das Gefühl vermittelt, schlimmer hätte es kommen können. „Selling a 10 and delivering a 6“, wie es US-Analysten nennen: Erst die 10 ankündigen – das Schlimmste also – und dann eine 6 liefern, die trotzdem gravierende Auswirkungen hat.
Was bedeutet das konkret?
Selbst die „6 von 10“ hat es in sich. Zölle von 20 % auf chinesische Waren oder 25 % auf bestimmte Produkte aus Kanada und Mexiko sind längst Realität. Unternehmen in den USA berichten von steigenden Kosten, unsicheren Planungsgrundlagen und erschwerten Lieferketten. Verbraucherinnen und Verbraucher spüren das zunehmend – das Verbrauchervertrauen ist laut aktuellen Umfragen auf dem tiefsten Stand seit 2021.
Politisches Kalkül oder echter Glaube an Zölle?
Trump bezeichnet sich selbst als „Tariff Man“. Es ist also naheliegend, dass er seine Zollpolitik nicht nur als Druckmittel sieht, sondern als festen Bestandteil seiner wirtschaftlichen Weltanschauung. Fairness im Handel – besonders gegenüber Ländern wie China oder Indien – ist ein zentrales Argument. Und reziproke Zölle sind für viele Amerikaner*innen leicht nachvollziehbar: Wenn sie uns besteuern, dann tun wir das auch.
Aber dahinter steckt auch ein politischer Effekt. Indem Trump reziproke Zölle als „fair“ verkauft und sektorale Zölle zeitlich streckt oder abschwächt, lenkt er die Debatte um – weg von wirtschaftlichen Risiken, hin zu patriotischen Botschaften. Ein geschickter rhetorischer Schachzug, der sich aber nicht unbedingt als nachhaltige Wirtschaftspolitik erweist.
Fazit: Der Wolf im Schafspelz?
Trumps Zölle sind kein harmloses „Weniger-schlimm-als-erwartet“-Szenario. Sie sind Teil eines kalkulierten Spiels mit Erwartungen, Ängsten und politischen Narrativen. Wer glaubt, er wolle bloß bluffen, irrt sich womöglich. Die echten Konsequenzen – für Unternehmen, Verbraucher und den Welthandel – sind real. Nur verkauft er sie eben besser.