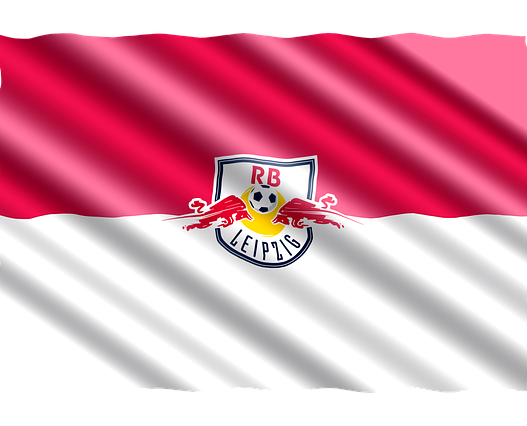Interview mit Fachanwalt für Datenschutzrecht Mike Rasch zur BGH-Entscheidung vom 27.03.2025 (I ZR 186/17)
Mit seinem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof ein deutliches Signal gesetzt: Datenschutzverstöße sind nicht nur Sache der Aufsichtsbehörden – auch Verbraucherschutzverbände und Mitbewerber dürfen sie zivilrechtlich verfolgen. Wir sprechen mit Mike Rasch, Fachanwalt für IT- und Datenschutzrecht, über die Bedeutung dieses Urteils, die möglichen Folgen für Unternehmen und was jetzt konkret zu tun ist.
Herr Rasch, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Datenschutzverstöße über das Wettbewerbsrecht verfolgt werden können. Wie bewerten Sie dieses Urteil?
Das Urteil ist wegweisend. Es bestätigt ganz klar, dass Datenschutz ein zentraler Bestandteil fairen Wettbewerbs ist. Unternehmen, die durch mangelhafte oder irreführende Datenschutzhinweise Wettbewerbsvorteile erzielen, handeln unlauter – und das kann jetzt nicht nur von Aufsichtsbehörden, sondern auch zivilrechtlich durch Mitbewerber und Verbraucherschutzverbände verfolgt werden. Das schafft ein neues Risikoumfeld.
Was ist an diesem Urteil besonders bedeutsam?
Der BGH verankert Datenschutzpflichten als Marktverhaltensregeln im Sinne des Wettbewerbsrechts. Das bedeutet: Datenschutz ist kein abgeschottetes Spezialthema mehr, sondern Teil der regulären Marktaufsicht durch die Zivilgerichte. Zudem stellt der BGH klar, dass eine Klage auch ohne konkrete betroffene Einzelperson möglich ist – das ist ein erheblicher Paradigmenwechsel.
Wie weit reicht diese Klagebefugnis – können jetzt beliebige Datenschutzverstöße abgemahnt werden?
Nein, das nicht. Es müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: Der Verstoß muss systematisch und relevant sein, insbesondere im Zusammenhang mit der Einholung oder der Ausgestaltung von Einwilligungen, Informationspflichten oder der Verwendung unzulässiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Wichtig ist aber: Unternehmen können sich nicht mehr hinter dem Argument verstecken, es habe „niemand konkret geklagt“. Das ist jetzt passé.
Was bedeutet das für Plattformen und Online-Händler, die viele personenbezogene Daten verarbeiten?
Sie stehen jetzt doppelt im Feuer: einerseits durch die Datenschutzaufsichtsbehörden – andererseits durch den zivilrechtlichen Druck durch Mitbewerber und Verbraucherschutzorganisationen. Wer in der Vergangenheit eher „nachlässig“ war, sollte dringend handeln. Vor allem Unternehmen, die personenbezogene Daten wirtschaftlich nutzen, etwa im Werbemarkt oder E-Commerce, sind jetzt stärker gefordert, Transparenz und Fairness nachweisbar umzusetzen.
Wie schätzen Sie die Auswirkungen für kleinere Unternehmen und Start-ups ein?
Auch sie sollten die Entscheidung ernst nehmen. Denn selbst kleinere Wettbewerber können nun aktiv werden, wenn sie durch datenschutzwidriges Verhalten anderer Marktteilnehmer benachteiligt werden. Natürlich ist die Schwelle zur Klage für große Verbände niedriger, aber auch Einzelhändler und Onlineanbieter haben jetzt ein Werkzeug in der Hand, um unfaire Marktpraktiken anzugreifen.
Die Entscheidung betrifft auch den Gesundheitsbereich – konkret Apotheken. Was sind hier die Besonderheiten?
Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert – das macht sie rechtlich sensibler. Der BGH hat auch bestätigt, dass ein Apotheker gegen einen anderen Apotheker klagen kann, wenn dieser ohne ausdrückliche Einwilligung Gesundheitsdaten bei Bestellungen verarbeitet. Das zeigt: Auch im Heilmittelbereich gilt Datenschutz nicht nur als ethische Norm, sondern als Wettbewerbsfaktor mit juristischer Relevanz.
Was müssen Unternehmen jetzt konkret tun, um sich rechtlich abzusichern?
Ich empfehle folgende drei Maßnahmen:
-
Transparenzpflichten aktualisieren: Datenschutzerklärungen und Einwilligungsformulare sollten klar, verständlich und vollständig sein – insbesondere zu Zweck, Umfang und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung.
-
Einwilligungen korrekt gestalten: Jede Einwilligung muss ausdrücklich, freiwillig und informiert erfolgen. Vorformulierte Checkboxen, die schon angehakt sind, gehören der Vergangenheit an.
-
AGB überprüfen: Viele Unternehmen nutzen datenschutzrelevante Klauseln in AGB, die nach diesem Urteil unzulässig sein könnten – etwa das automatische Posten im Namen von Nutzern, wie im konkreten Fall gegen Facebook. Hier drohen Unterlassungsklagen und Kosten.
Zusätzlich sollten interne Prozesse, wie der Umgang mit Nutzeranfragen oder der Datenzugriff durch Dritte, regelmäßig geprüft und dokumentiert werden.
Rechnen Sie mit einer „Abmahnwelle“ in der Praxis?
Eine Welle vielleicht nicht – aber mit einer deutlich spürbaren Zunahme an Verfahren, insbesondere durch große Verbraucherschutzverbände oder Interessengemeinschaften. Das Urteil bietet ihnen jetzt eine stabile Rechtsgrundlage. Wer gut vorbereitet ist, muss sich aber nicht fürchten – das Ziel ist ja letztlich Fairness und Verbraucherschutz, nicht Schikane.
Gibt es auch Chancen für Unternehmen in dieser Entscheidung?
Absolut. Unternehmen, die Datenschutz ernst nehmen und transparent agieren, können sich jetzt besser gegen Wettbewerber wehren, die sich unlautere Vorteile durch intransparente Praktiken verschaffen. Gleichzeitig schafft die Entscheidung mehr Vertrauen bei Verbrauchern – und das ist heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.
Letzte Frage: Was erwarten Sie langfristig?
Langfristig wird Datenschutz in Deutschland stärker als integrativer Bestandteil des unternehmerischen Risikomanagements gesehen. Die Verzahnung mit dem Wettbewerbsrecht wird dazu führen, dass Geschäftsmodelle früher rechtlich geprüft und sauberer aufgebaut werden müssen. Das ist gut für Verbraucher – aber auch für die Fairness im Markt insgesamt.
Herr Rasch, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gern. Bleiben wir wachsam – und datenschutzkonform.