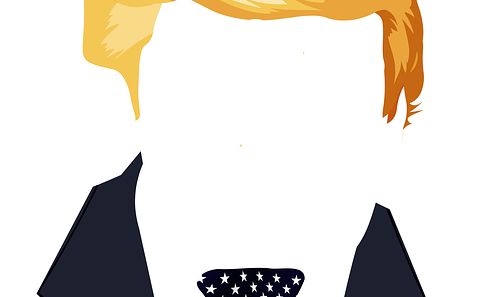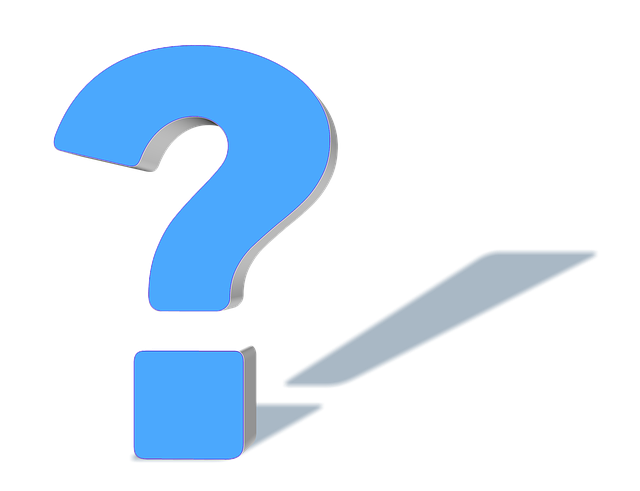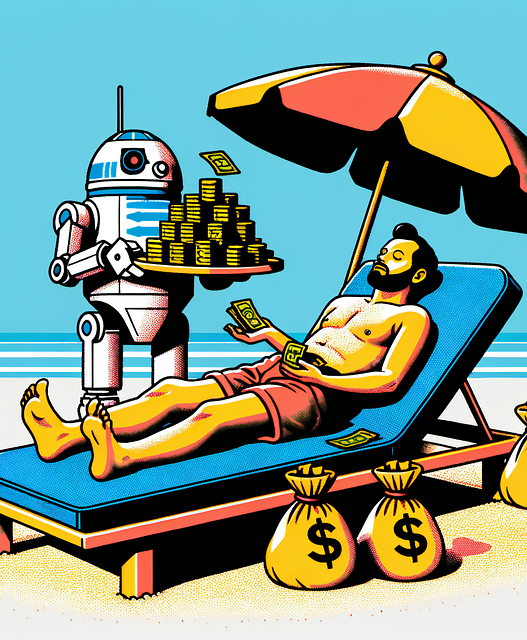US-Präsident Donald Trump hat neue Autozölle angekündigt und prophezeit, dass diese zu einer Rückverlagerung der Produktion und Lieferketten in die USA führen würden. Doch die Realität in der Automobilbranche sieht deutlich komplexer aus – und die Reaktionen der Hersteller sind verhalten.
Ab dem 3. April sollen neue Strafzölle auf Autos und Autoteile aus Asien, Europa, Kanada und Mexiko greifen. Besonders die Zölle auf Produkte aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko könnten die Automobilindustrie hart treffen, da viele US-Hersteller auf deren Produktionskapazitäten und Zulieferteile angewiesen sind.
Trump: „Wer in den USA baut, zahlt keine Zölle“
Trump erklärte im Oval Office, dass es keine Zölle für Autos gebe, die in den USA gebaut werden. Doch das neue Maßnahmenpaket umfasst auch viele Teile, die in amerikanischen Fabriken verbaut werden. Damit könnten selbst Fahrzeuge, die in den USA montiert werden, deutlich teurer werden – mit zusätzlichen Kosten von bis zu 12.000 US-Dollar pro Fahrzeug, wie das Anderson Economic Group schätzt.
Branchenreaktion: „Kosten und Chaos“
Ford-CEO Jim Farley sprach zuletzt von „hohen Kosten und großem Chaos“, das durch Trumps Zollpolitik ausgelöst werde. Dennoch planen weder Ford noch andere Hersteller aktuell, neue Werke in den USA zu bauen. Die Unsicherheit über die Dauer und Zielrichtung der Zölle hemmt langfristige Investitionsentscheidungen.
Paul Jacobson, Finanzchef von General Motors, machte deutlich: Man könne keine Milliardeninvestitionen tätigen, wenn unklar sei, wie sich die Handelspolitik entwickle. „Wir können das Geschäft nicht hin- und herreißen“, so Jacobson.
Trump erklärte die Zölle für „permanent“ – zumindest für die Dauer seiner Amtszeit. Dennoch herrscht in der Branche Skepsis: Frühere Zollankündigungen wurden mehrfach verschoben oder wieder aufgehoben. Viele Hersteller warten ab, bevor sie Milliardenbeträge in neue Standorte stecken.
Produktion verlagern? Nicht so einfach
Ein hochrangiger Branchenvertreter sagte CNN, dass eine kurzfristige Produktionsverlagerung nahezu unmöglich sei. Neue Werke erfordern jahrelange Planung, Genehmigungen und Investitionen. Selbst die Umstellung eines bestehenden Werks auf ein neues Modell kann mehr als ein Jahr dauern.
Ein Beispiel: Stellantis kündigte nach dem UAW-Streik 2023 an, ein geschlossenes Werk in Belvidere, Illinois, wieder zu eröffnen. Doch die Produktion soll dort frühestens 2027 wieder anlaufen – vier Jahre nach der Entscheidung.
Kein „100 % amerikanisches Auto“
Selbst Autos, die in den USA gebaut werden, bestehen zum Großteil aus importierten Teilen. Viele stammen aus Kanada, Mexiko oder Asien. Diese Lieferketten umzubauen, ist kostspielig und zeitaufwendig. Neue US-Zulieferer müssten zunächst zertifiziert werden – ein Prozess, der Monate oder Jahre dauern kann.
Hinzu kommt: Auch die Preise für inländische Rohstoffe wie Stahl und Aluminium steigen. Seit Januar sind US-Stahlpreise um über 30 % gestiegen, Aluminium um rund 15 %. Schon frühere Zölle auf kanadische Metalle kosteten GM und Ford jeweils über eine Milliarde Dollar jährlich.
Trumps Erfolgsmeldungen – Realität oder Rhetorik?
Trump behauptete zuletzt vor dem Kongress, dass zahlreiche neue Werke entstünden. Als Beispiel nannte er ein angeblich im Bau befindliches Honda-Werk in Indiana – doch Honda widersprach: Eine solche Fabrik sei bislang nicht angekündigt.
Tatsächlich stammen die meisten derzeit entstehenden Werke – insbesondere für E-Autos und Batterien – aus der Zeit der Biden-Regierung und werden durch Mittel aus dem Inflation Reduction Act finanziert. Trump kündigte jedoch an, dieses Programm rückgängig machen zu wollen.
Fazit
Auch wenn Trump auf kurzfristige Industriebooms durch Zölle hofft, zeichnet sich in der Realität ein anderes Bild: Hersteller reagieren vorsichtig, Unsicherheiten bleiben groß, und eine schnelle Rückverlagerung der Produktion ist ökonomisch und logistisch kaum machbar. Stattdessen drohen höhere Preise – für Hersteller wie auch für Konsumenten.