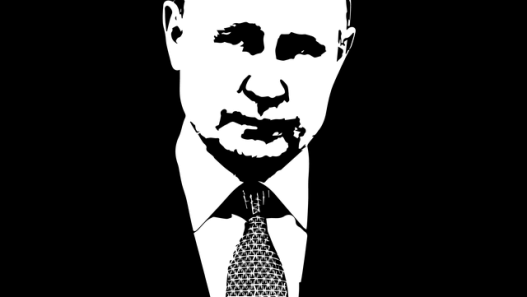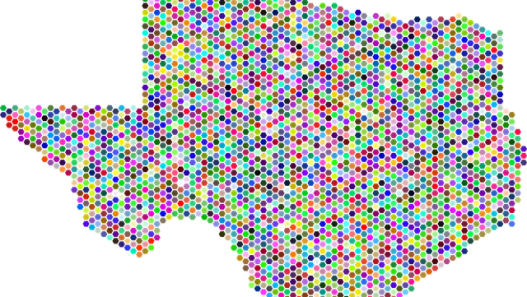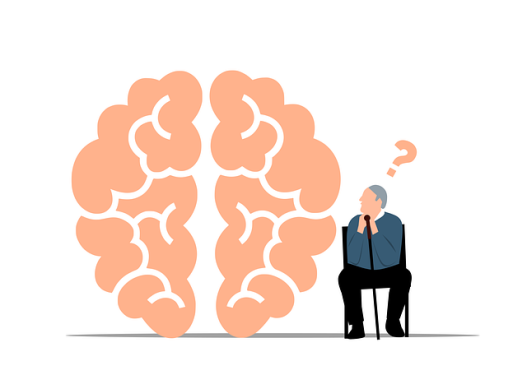Demenz ist auf dem Vormarsch – auch in Bayern. Während die Zahl der Betroffenen steigt, ringen Ehrenamtliche, Angehörige und Politiker um Lösungen. Doch während die einen über Hürden klagen, betont die Politik, wie gut Bayern aufgestellt sei. Die Realität? Ein Drahtseilakt zwischen Engagement, bürokratischen Stolpersteinen und steigenden Anforderungen.
Wenn Erinnerungen verblassen – und die Unterstützung auch
Ein 76-Jähriger beschreibt seinen ersten Schwindelanfall als Moment der Orientierungslosigkeit: „Du weißt nicht, wo du bist.“ Drei Jahre später lebt er mit der Diagnose Alzheimer-Demenz. Zusammen mit seiner Frau sucht er Unterstützung – und findet sie im „Café Vergissmeinnicht“, einer Initiative der Alzheimergesellschaft Pfaffenhofen.
Hier treffen sich Betroffene und Angehörige – auf ehrenamtlicher Basis organisiert. Doch was für den Mann und seine Frau eine wertvolle Anlaufstelle ist, ist für die Organisatoren eine zunehmende Herausforderung. Barbara Bardong, Vorsitzende der Gesellschaft, spricht Klartext: „Wir bräuchten mehr Jüngere, denn die Älteren brechen irgendwann weg.“ Ehrenamtliches Engagement schwindet, während der Bedarf wächst.
Zahlen, die Sorgen machen
Die Statistik ist eindeutig: Derzeit leben in Bayern rund 270.000 Menschen mit Demenz. Bis 2030 könnten es laut Prognosen bereits 300.000 sein. Die Folge? Ein noch größerer Bedarf an Unterstützung, Pflege und spezialisierten Angeboten. Doch während die Zahl der Erkrankten steigt, schrumpft die Zahl der regionalen Alzheimer-Gesellschaften – von ehemals 27 auf mittlerweile 26.
Warum? Sonja Womser, Leiterin des Landesverbands Bayern der Alzheimer Gesellschaft, bringt es auf den Punkt: „Demenz ist ein schweres Thema.“ Nicht nur für Betroffene und ihre Familien, sondern auch für ehrenamtliche Helfer. Denn ohne finanzielle Unterstützung und bürokratische Entlastung bleibt vieles auf der Strecke.
Geld wäre da – wenn man es nutzen könnte
Dabei gibt es eigentlich finanzielle Hilfen: Die Pflegekassen stellen bereits ab Pflegegrad 1 einen Entlastungsbetrag von bis zu 125 Euro im Monat zur Verfügung. Klingt gut – doch viele Familien können das Geld gar nicht abrufen. Warum? Weil bürokratische Hürden die Nutzung komplizierter machen, als sie sein sollte. Unterstützung im Haushalt, Begleitdienste – alles theoretisch förderfähig, praktisch aber oft mit enormem Aufwand verbunden.
Womser fordert deshalb mehr als warme Worte: Fördergelder, die leichter abrufbar sind, weniger Bürokratie und vor allem mehr politische Unterstützung.
Die bayerische Regierung: „Wir tun doch schon was!“
Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) sieht die Lage weniger dramatisch. Seit 2013 gibt es eine Demenzstrategie, Fördergelder im zweistelligen Millionenbereich und Initiativen wie den Bayerischen Demenzpreis. Projekte sollen als Vorbild für andere Regionen dienen – doch ob das reicht?
Während die Regierung sich auf dem Erreichten ausruht, kämpfen Ehrenamtliche an der Front um jeden Euro, jede helfende Hand und jeden Bürokratieakt, der das Leben der Betroffenen erleichtern könnte.
Fazit: Bayern zwischen Engagement und Realität
Während Bayerns Demenzstrategie auf dem Papier gut aussieht, zeigt sich in der Praxis eine andere Realität:
✅ Es gibt engagierte Ehrenamtliche, die sich trotz aller Hürden für Betroffene einsetzen.
✅ Fördergelder sind theoretisch vorhanden.
❌ Doch ohne Bürokratieabbau bleiben viele Mittel ungenutzt.
❌ Ehrenamtliche Strukturen brechen weg, während die Zahl der Demenzkranken steigt.
❌ Die politischen Maßnahmen bleiben oft Symbolpolitik statt echter Entlastung.
Ob Bayern wirklich gut auf die Demenz-Welle vorbereitet ist, bleibt fraglich. Sicher ist nur: Sie kommt – und die Zeit, sich darauf vorzubereiten, läuft langsam ab.