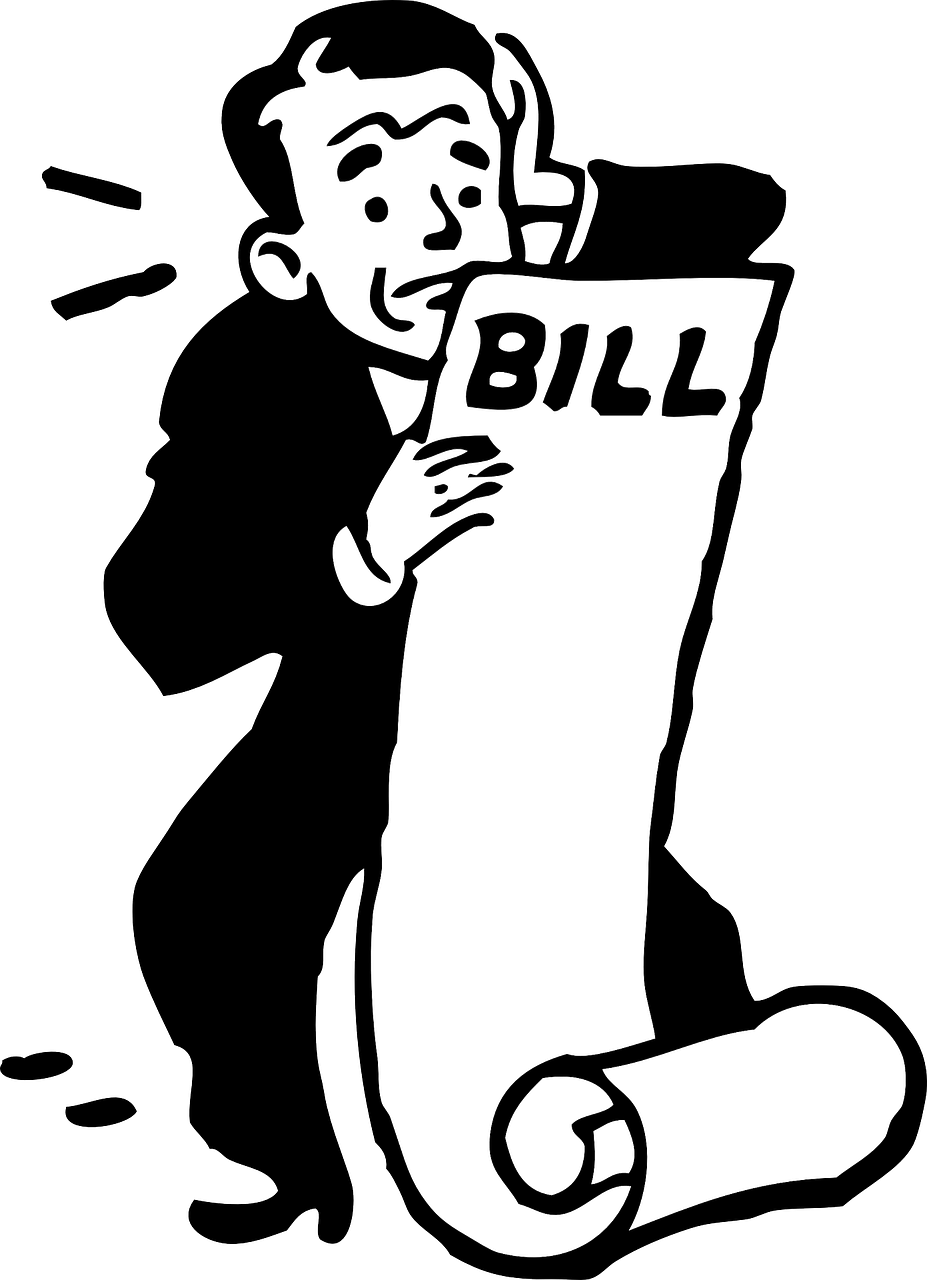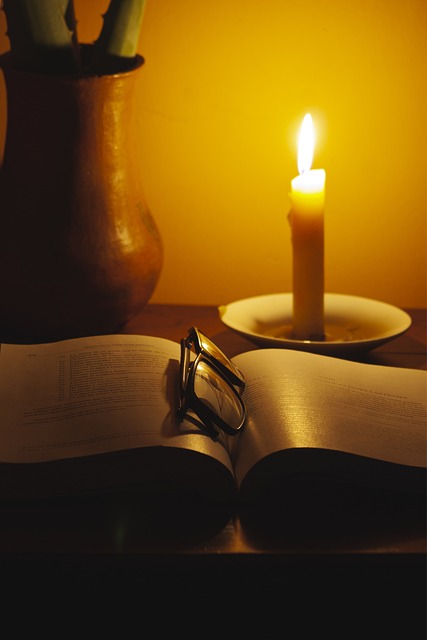Überschuldete Verbraucher haben die Möglichkeit, sich innerhalb von drei Jahren von ihren Schulden zu befreien. Dieses Verfahren, auch Verbraucherinsolvenz genannt, bietet Betroffenen eine zweite Chance auf einen finanziellen Neuanfang. Doch wie läuft das Verfahren genau ab, welche Pflichten gibt es und welche Fehler sollten vermieden werden?
Was bedeutet Privatinsolvenz?
Die Privatinsolvenz ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren, mit dem überschuldete Personen ihre finanziellen Verpflichtungen innerhalb von drei Jahren begleichen oder erlassen bekommen können. Selbst wer über keinerlei pfändbares Einkommen oder Vermögen verfügt, kann teilnehmen und am Ende schuldenfrei sein.
Wie funktioniert das Insolvenzverfahren?
Der erste Schritt ist der Versuch einer außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern. Dies erfolgt mit Unterstützung einer Schuldnerberatungsstelle oder eines Anwalts. Scheitert dieser Versuch, kann ein Antrag auf Insolvenz beim zuständigen Gericht gestellt werden.
Das Verfahren gliedert sich in mehrere Phasen:
- Außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigern
- Antragstellung beim Insolvenzgericht mit Bescheinigung über das Scheitern der außergerichtlichen Einigung
- Eröffnung des Insolvenzverfahrens, in dem Vermögenswerte verwertet und Schulden erfasst werden
- Wohlverhaltensphase, in der das pfändbare Einkommen an einen Treuhänder abgeführt wird
- Restschuldbefreiung, die nach drei Jahren erfolgt und sämtliche verbleibenden Schulden erlöschen lässt
Welche Pflichten bestehen während der Wohlverhaltensphase?
Während des Insolvenzverfahrens müssen Schuldner bestimmte Regeln einhalten:
- Offenlegung aller Einkommens- und Vermögensverhältnisse
- Abtretung des pfändbaren Einkommens an den Insolvenzverwalter
- Pflicht zur Arbeitsaufnahme oder zumutbaren Bemühung um eine Beschäftigung
- Meldepflicht bei Wohnsitz- oder Arbeitgeberwechsel
- Keine neuen Schulden aufnehmen, die nicht bezahlt werden können
Wer gegen diese Pflichten verstößt, riskiert das Scheitern der Insolvenz und verliert die Chance auf Restschuldbefreiung.
Welche Kosten entstehen?
Das Verfahren verursacht Gerichts- und Verwaltungskosten sowie eventuell Anwaltskosten. Wer nicht in der Lage ist, diese zu zahlen, kann eine Stundung beantragen. In diesem Fall werden die Kosten erst nach Abschluss des Verfahrens fällig und müssen nur gezahlt werden, wenn sich die finanzielle Lage verbessert.
Was darf ich während der Insolvenz behalten?
- Das Existenzminimum bleibt unangetastet. Der unpfändbare Teil des Einkommens richtet sich nach der gesetzlichen Pfändungstabelle.
- Ein Auto kann unter bestimmten Bedingungen behalten werden, wenn es für die Arbeit oder eine Behinderung notwendig ist.
- Mietwohnungen sind nicht betroffen, die Miete muss jedoch weiterhin selbst gezahlt werden.
- Erbschaften müssen zur Hälfte an den Insolvenzverwalter abgeführt werden.
Welche Schulden werden nicht erlassen?
Nicht alle Schulden werden durch die Insolvenz getilgt. Ausgenommen sind unter anderem:
- Schulden aus vorsätzlichen Straftaten
- Unterhaltsschulden bei bewusster Verletzung der Zahlungspflicht
- Steuerhinterziehung
Kann ich auch ohne Gerichtsverfahren schuldenfrei werden?
Ja, wenn eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern gelingt. Dies setzt jedoch voraus, dass die Gläubiger zustimmen und sich auf eine freiwillige Schuldenregelung einlassen.
Fazit: Eine Chance auf einen Neustart
Die Privatinsolvenz ist ein gesetzlich geregelter Weg aus der Schuldenfalle. Wer sich an die Regeln hält, kann innerhalb von drei Jahren einen finanziellen Neuanfang wagen. Wer sich beraten lässt, Fehler vermeidet und seine Pflichten erfüllt, hat eine realistische Chance, dauerhaft schuldenfrei zu werden.