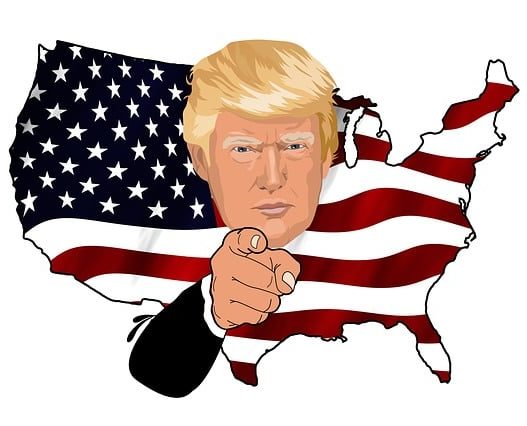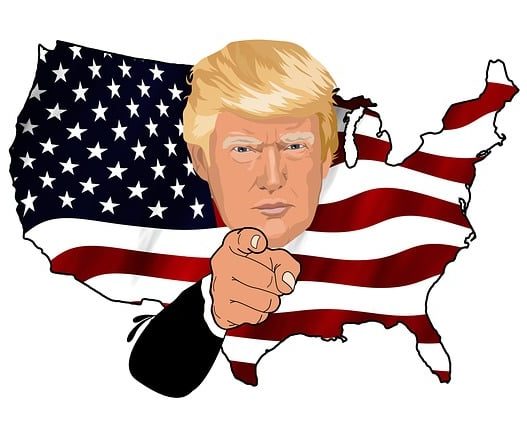Die Zahl der Menschen mit diagnostizierten Angststörungen hat in Deutschland in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Wie eine aktuelle Hochrechnung der KKH Kaufmännische Krankenkasse zeigt, waren 2023 etwa 5,5 Millionen Menschen bundesweit von einer solchen Erst- oder Folgediagnose betroffen. Vergleicht man diese Zahl mit 2008, entspricht dies einem Anstieg von 77 Prozent. Diese Entwicklung wirft drängende Fragen über die Ursachen, Auswirkungen und Handlungsansätze im Umgang mit psychischen Erkrankungen auf.
Was sind Angststörungen?
Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und manifestieren sich in verschiedenen Formen. Dazu zählen generalisierte Angststörungen, Panikstörungen und soziale Phobien. Die Symptome reichen von körperlichen Beschwerden wie Herzrasen, Brustschmerzen, Erstickungsgefühlen und Schwindel bis hin zu schwerwiegenden Panikattacken, die Betroffene stark einschränken können. Oft treten diese Symptome plötzlich und ohne erkennbaren Grund auf, was die Erkrankung für die Betroffenen zusätzlich belastend macht.
Neben den körperlichen Symptomen beeinflusst eine Angststörung auch die psychische Verfassung und den Alltag der Betroffenen erheblich. Häufig ziehen sich Betroffene aus ihrem sozialen Umfeld zurück, vermeiden bestimmte Situationen oder Orte und entwickeln ein dauerhaftes Gefühl von Unsicherheit. Dies kann langfristig auch zu anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen führen.
Mögliche Ursachen für den starken Anstieg
Die Gründe für den starken Anstieg von Angststörungen in Deutschland sind vielfältig und komplex. Ein entscheidender Faktor könnte die steigende gesellschaftliche Sensibilisierung für psychische Erkrankungen sein, wodurch mehr Menschen ärztliche Hilfe suchen und diagnostiziert werden. Gleichzeitig hat sich die Bereitschaft vieler Ärzte erhöht, solche Erkrankungen zu erkennen und entsprechend zu behandeln.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre. Wachsende Anforderungen im Berufsleben, Unsicherheiten durch politische und wirtschaftliche Krisen sowie die zunehmende Digitalisierung und der damit verbundene soziale Druck könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Besonders die Corona-Pandemie hat die psychische Gesundheit vieler Menschen stark belastet, sei es durch Isolation, Existenzängste oder Unsicherheiten über die Zukunft.
Auch die sozialen Medien und der ständige Vergleich mit anderen können bei vielen Menschen ein Gefühl von Unzulänglichkeit und Überforderung hervorrufen, das in Angststörungen münden kann. Hinzu kommen familiäre oder genetische Prädispositionen, die ebenfalls zur Entstehung solcher Erkrankungen beitragen können.
Versorgungslage und gesellschaftliche Herausforderungen
Die steigenden Zahlen machen deutlich, dass der Bedarf an präventiven Maßnahmen und therapeutischen Angeboten wächst. Allerdings stößt das Gesundheitssystem in diesem Bereich immer wieder an seine Grenzen. Längere Wartezeiten für Therapieplätze und eine ungleiche Verteilung von psychologischen Fachkräften zwischen städtischen und ländlichen Regionen erschweren es Betroffenen, schnell Hilfe zu bekommen.
Die KKH hat ihre Daten auf Grundlage anonymisierter Mitgliederstatistiken hochgerechnet. Dies zeigt, dass es sich bei den 5,5 Millionen Betroffenen nur um die offiziell erfassten Fälle handelt. Dunkelziffern könnten die tatsächlichen Zahlen noch erheblich in die Höhe treiben, denn viele Menschen suchen aufgrund von Scham oder mangelnder Aufklärung keine professionelle Hilfe.
Was muss geschehen?
Der deutliche Anstieg diagnostizierter Angststörungen ist nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ein gesellschaftliches Warnsignal. Politik und Gesundheitswesen sind gefordert, die Versorgung psychisch erkrankter Menschen auszubauen und Präventionsmaßnahmen zu stärken. Dazu gehören unter anderem:
Bessere Aufklärung: Öffentlichkeitskampagnen können helfen, Vorurteile und Stigmata gegenüber psychischen Erkrankungen abzubauen und Betroffene dazu ermutigen, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung: Die Schaffung zusätzlicher Therapieplätze sowie die Förderung von Telemedizin und Online-Beratungsangeboten könnten dazu beitragen, die Versorgungslage zu verbessern.
Prävention am Arbeitsplatz: Arbeitgeber sollten verstärkt auf die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden achten und Programme zur Stressbewältigung und Resilienzförderung anbieten.
Förderung der Forschung: Um die Ursachen von Angststörungen besser zu verstehen, ist es wichtig, die psychologische und medizinische Forschung in diesem Bereich weiter voranzutreiben.
Fazit
Der Anstieg der diagnostizierten Angststörungen in Deutschland ist ein Weckruf. Die Zahlen zeigen, dass psychische Erkrankungen keine Randerscheinung mehr sind, sondern ein immer zentraleres gesellschaftliches Problem darstellen. Es ist höchste Zeit, dass Politik, Gesundheitswesen und Gesellschaft gemeinsam handeln, um die Betroffenen besser zu unterstützen und langfristig die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu fördern. Nur durch präventive Maßnahmen, eine bessere Versorgung und ein stärkeres Bewusstsein für dieses Thema können wir dieser Entwicklung entgegenwirken.