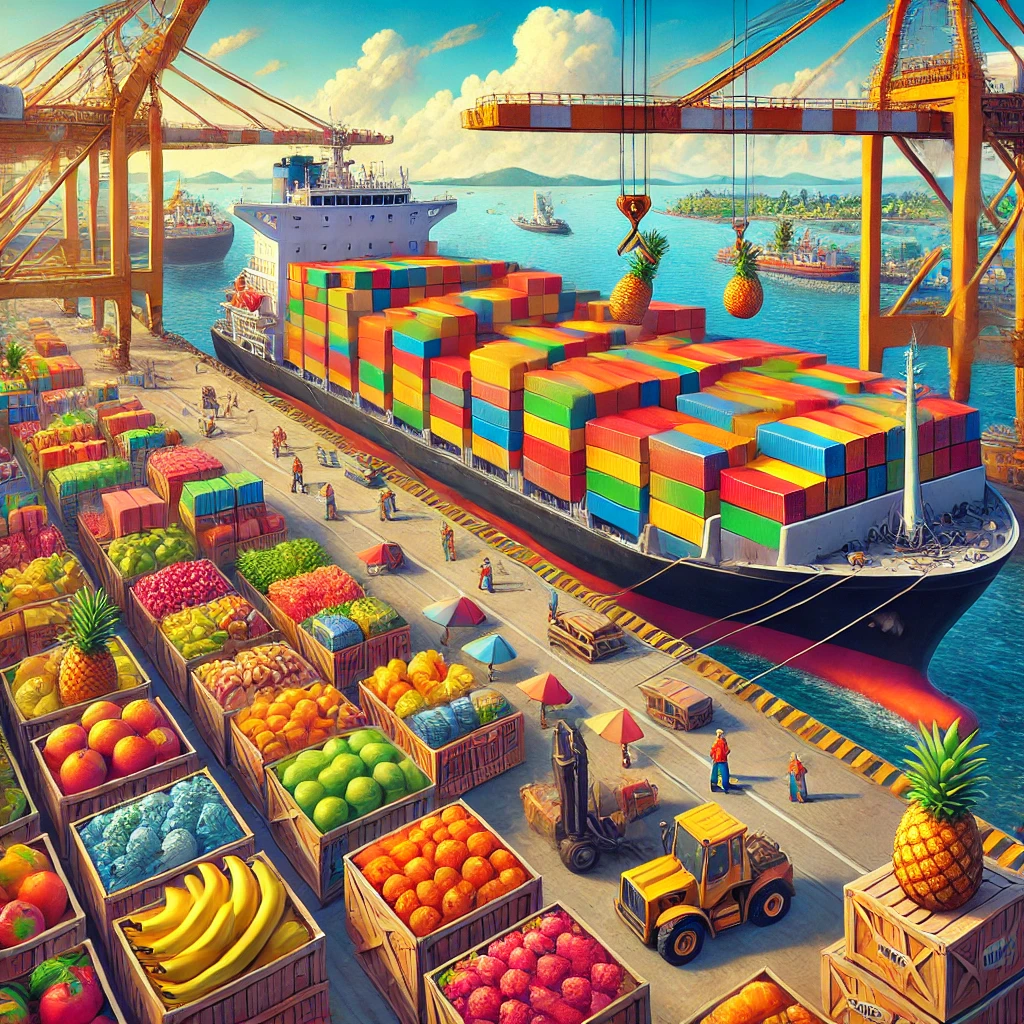Die künstliche Intelligenz (KI) erobert zunehmend auch den Bereich der Haustiere. Mit dem KI-Kuschelhamster „Moflin“, entwickelt vom japanischen Unternehmen Casio, wurde ein Produkt geschaffen, das Einsamkeit lindern und emotionale Bindungen aufbauen soll. Bereits kurz nach Verkaufsstart war der flauschige Begleitroboter in Japan ausverkauft – ein Erfolg, der jedoch Fragen nach den Risiken und der ethischen Dimension künstlicher Emotionen aufwirft.
Ein Haustier aus dem Labor
Das einem Meerschweinchen oder Hamster nachempfundene „Moflin“ ist laut Casio speziell darauf ausgelegt, „Beziehungen zu Menschen aufzubauen“. Ähnlich wie reale Haustiere soll der Roboter dabei helfen, Einsamkeit zu überwinden. Mit einem Verkaufsstart am Welttag der psychischen Gesundheit, dem 10. Oktober, traf Casio offenbar einen Nerv. Binnen kürzester Zeit waren die ersten Exemplare vergriffen. Bis Ende März 2025 plant das Unternehmen den Verkauf von 6.000 Stück zu einem Preis von rund 300 Euro pro Einheit.
Emotionale Fähigkeiten und Interaktion
Laut Casio verfügt „Moflin“ über emotionale Fähigkeiten, die sich durch tägliche Interaktion mit seiner Umgebung entwickeln. Der Roboter zeigt scheinbar Stress, Freude oder Müdigkeit und reagiert mit Geräuschen und Bewegungen. Beispielsweise „schläft“ er in seiner Ladestation und erkennt die Stimme seines Besitzers, was er mit einem leichten Quietschen signalisiert. Eine begleitende App liefert zusätzliche Informationen, etwa ob der „Moflin“ „ängstlich“ oder „hungrig“ ist.
Dank einer integrierten „Gefühlskarte“ soll der Roboter sogar eine individuelle Persönlichkeit entwickeln, die sich an den Besitzer anpasst. Dies alles ist darauf ausgerichtet, eine emotionale Bindung zwischen Mensch und Maschine zu schaffen.
Kritische Reflexion: Die Gefahr der emotionalen Manipulation
Trotz der scheinbaren Vorteile warnt Christopher Frauenberger, Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Interdisciplinary University in Linz, vor möglichen Risiken. „Es wird so dargestellt, als ob dieses Ding Emotionen hätte und auf Emotionen reagieren könnte. Und das kann es natürlich nicht“, erklärt Frauenberger im Gespräch mit ORF Topos. Vielmehr handelt es sich um eine perfekte Simulation von Gefühlen, die so überzeugend ist, dass Menschen unweigerlich darauf reagieren.
Frauenberger sieht hier eine potenzielle Gefahr: „Emotionale Manipulation ist etwas, gegen das sich Menschen nur schwer wehren können.“ Der Roboter mag Einsamkeit lindern oder therapeutische Unterstützung bieten, doch die Illusion echter Emotionen könne auch Abhängigkeiten schaffen und ethische Fragen aufwerfen.
Einfluss auf Pflege und Gesellschaft
Besonders im Pflegebereich könnten derartige Begleitroboter künftig eine wichtige Rolle spielen. Sie könnten ältere oder einsame Menschen unterstützen, ohne dass menschliches Personal rund um die Uhr verfügbar ist. Doch auch hier mahnen Experten zur Vorsicht: Sollten Maschinen emotionale Bindungen vortäuschen, könnte dies die sozialen Beziehungen zwischen Menschen weiter verdrängen.
Ein Blick in die Zukunft
Produkte wie „Moflin“ verdeutlichen, wie tief künstliche Intelligenz in den Alltag eindringen kann. Während ihre Anwendung für Einsamkeitsbewältigung oder Unterhaltung zweifellos Vorteile bietet, zeigt sie auch die Risiken auf, die entstehen, wenn Maschinen Emotionen simulieren.
Die Entwicklung solcher Roboter fordert Gesellschaft, Politik und Wissenschaft gleichermaßen heraus, über ethische und soziale Implikationen nachzudenken. Denn hinter dem „süßen Fellknäuel“ verbirgt sich nicht nur ein High-Tech-Spielzeug, sondern auch eine Technologie mit enormem Potenzial – und erheblichen Gefahren.