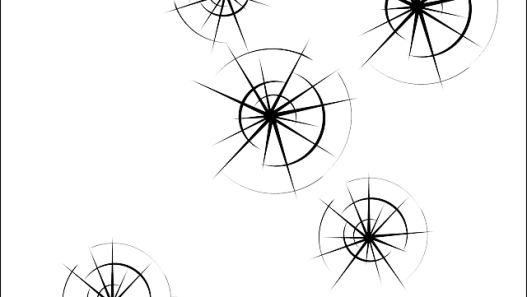Die Diskussion über das Strafvollzugssystem und alternative Strafmaßnahmen rückt mit den nationalen Gefängnistagen vom 14. bis 24. November 2024 in den Fokus. Besonders im französischsprachigen Belgien sowie in Flandern ist die Nutzung elektronischer Fußfesseln in den letzten Jahren stark gestiegen. Doch ob diese Form der Überwachung tatsächlich eine sinnvolle Alternative zur Gefängnisstrafe ist, bleibt umstritten.
Ein Blick auf die Zahlen
Die Anzahl der unter elektronischer Überwachung stehenden Personen hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Allein in Belgien tragen über 11.000 Menschen eine elektronische Fußfessel – fast so viele wie die Gesamtzahl der Gefängnisinsassen. Der Anstieg hat insbesondere seit 2021 stark zugenommen, auch in Flandern, wo allein im letzten Jahr ein Plus von 30 % verzeichnet wurde.
Die Vorteile der elektronischen Überwachung
Richter und Befürworter der elektronischen Fußfesseln argumentieren, dass dieses System mehrere Vorteile bietet:
Entlastung der Gefängnisse: Angesichts chronischer Überbelegung kann die elektronische Überwachung Gefängnisse entlasten.
Förderung der sozialen Wiedereingliederung: Personen, die überwacht werden, können oft in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und leichter eine berufliche oder soziale Reintegration anstreben.
Vermeidung der negativen Folgen einer Inhaftierung: Gefängnisaufenthalte können oft eine Desozialisierung und Stigmatisierung fördern, die mit elektronischen Fußfesseln vermieden werden können.
Kritik an der Praxis
Trotz der theoretischen Vorteile wird die Nutzung elektronischer Fußfesseln auch stark kritisiert. Viele Experten und Betroffene sprechen von einer „trügerischen Freiheit“.
Einschränkungen und Isolation: Die Betroffenen berichten von einem strengen Kontrollsystem, das Bewegungsfreiheit und soziale Integration stark einschränkt. So beschreibt ein ehemaliger Gefangener die Fußfessel als „eine falsche Freiheit“, da man ständig überwacht wird – selbst in den eigenen vier Wänden.
Erschwerte berufliche Wiedereingliederung: Der Aufwand, Termine und Bewegungen nachzuweisen, sowie die Stigmatisierung durch die Fußfessel erschweren es, einen Arbeitsplatz zu finden.
Finanzielle Probleme: Personen unter elektronischer Überwachung erhalten oft eine Unterhaltsbeihilfe, die seit 2007 nicht mehr angepasst wurde und deutlich unter der Armutsgrenze liegt (ca. 650 Euro pro Monat für Alleinstehende).
Wird das Ziel erreicht?
Ein Hauptziel der elektronischen Überwachung ist die Reduktion von Gefängnisüberbelegung. Doch Daten zeigen ein anderes Bild: Während die Nutzung von Fußfesseln zunimmt, steigt auch die Zahl der Inhaftierten. Gleichzeitig sinken die Kriminalitätsraten – ein Widerspruch, der Fragen zur Effektivität des Systems aufwirft.
Olivia Nerderlandt, Professorin für Strafrecht an der UCLouvain Saint-Louis, erklärt: „Elektronische Überwachung sollte eigentlich eine Alternative zur Inhaftierung sein, entwickelt sich jedoch immer mehr zu einer Ergänzung, die zusätzlich zur steigenden Zahl der Gefängnisinsassen genutzt wird.“
Was wäre eine bessere Alternative?
Experten plädieren für einen stärkeren Fokus auf maßgeschneiderte Reintegrationsprogramme:
Unterstützung durch Fachkräfte: Rechtsbeistand oder Sozialarbeiter könnten die Betroffenen aktiv bei der Wiedereingliederung unterstützen – sei es bei der Jobsuche, Wohnungsfragen oder bürokratischen Angelegenheiten.
Auflagen statt Überwachung: Entlassungen mit spezifischen Auflagen könnten effektiver sein, wenn sie durch unterstützende Maßnahmen begleitet werden.
Langfristige Perspektiven: Ziel sollte es sein, den Betroffenen eine echte Chance auf ein eigenständiges Leben ohne erneuten Rückfall zu geben, statt sie durch restriktive Kontrollen zu isolieren.
Fazit
Elektronische Fußfesseln sind eine praktische Lösung, um Gefängnisse zu entlasten und negative Folgen einer Inhaftierung zu vermeiden. Doch die Kritik zeigt, dass sie oft nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Stattdessen könnten unterstützende Maßnahmen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind, langfristig effektiver sein. Es bleibt abzuwägen, ob elektronische Überwachung als Ergänzung oder Alternative zum Strafvollzug genutzt werden sollte – und welche Reformen nötig sind, um eine nachhaltige Resozialisierung zu ermöglichen.