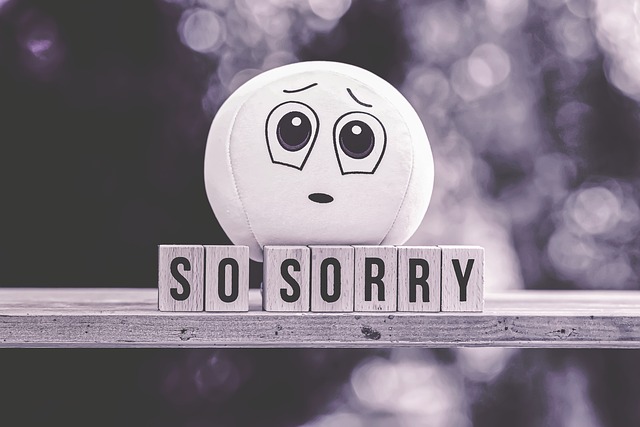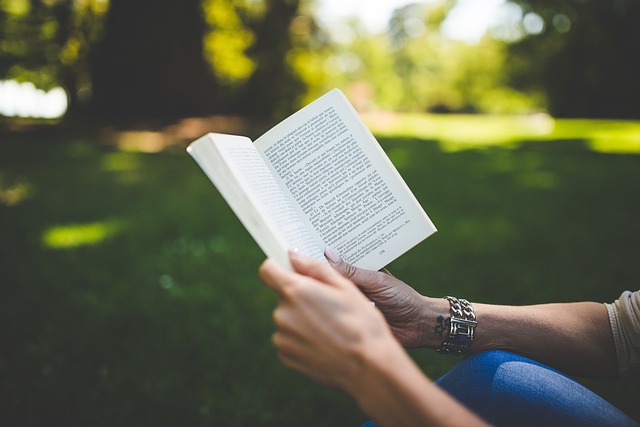Ein Schweizer Forschungsprojekt entwickelt einen bahnbrechenden Rollstuhl, der mithilfe von Drohnen und künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird und Menschen mit Behinderungen eine größere Unabhängigkeit und gesellschaftliche Integration ermöglichen soll. Dabei ergeben sich jedoch technische, ethische und rechtliche Herausforderungen, die es noch zu überwinden gilt.
Technologie für mehr Inklusion
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz setzen sich mit der Volksinitiative „Für Inklusion“ für ihre Rechte ein, darunter die freie Wahl des Wohnorts und die volle gesellschaftliche Teilhabe. Trotz rechtlicher Fortschritte bleiben grundlegende Freiheiten wie die Freizügigkeit oft unerreichbar. Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung dieser Probleme ist die Entwicklung autonomer Technologien wie der Drohnen-gesteuerten Rollstühle, an denen Forscher aus der Schweiz und anderen europäischen Ländern arbeiten. Francesco Flammini, Leiter des Projekts am Dalle Molle Institut für Künstliche Intelligenz in Lugano, sieht darin einen Meilenstein für die Autonomie von Menschen mit körperlichen und sensorischen Einschränkungen.
Die transformative Wirkung intelligenter Rollstühle
Laut Benjamin Kuipers, emeritierter Professor der Universität von Michigan, bieten intelligente Rollstühle transformative Möglichkeiten für Menschen mit schweren Behinderungen. Dennoch sind ethische Fragen entscheidend: Roboter müssen vertrauenswürdig sein, um autonom in Zusammenarbeit mit Menschen zu funktionieren. Auch wenn die technologische Entwicklung voranschreitet, sind viele dieser Ideen noch weit von einer Marktreife entfernt.
Herausforderung: Sichere Straßenüberquerung
Eine der größten Herausforderungen für Entwickler ist die sichere und autonome Straßenüberquerung. Durch den Einsatz von Sensoren, Kameras und Drohnen wird versucht, den Rollstuhl so zu gestalten, dass er in unterschiedlichen realen Szenarien sicher funktioniert. Drohnen spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren und Gefahren im Voraus erkennen können.
Sicherheitsbedenken und soziale Akzeptanz
Obwohl die Drohnentechnologie viele Vorteile für die Sicherheit bietet, gibt es Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz. Benjamin Kuipers weist darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen möglicherweise nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wollen, wenn Drohnen sie ständig begleiten. Dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und sozialer Akzeptanz muss bei der weiteren Entwicklung berücksichtigt werden.
Ethische und rechtliche Hürden
Die Komplexität KI-basierter Systeme wirft zudem rechtliche Fragen auf. Besonders problematisch ist die mangelnde Transparenz solcher Systeme, die es schwierig macht, im Falle eines Unfalls die Verantwortung zu klären. Diese Unsicherheiten betreffen nicht nur die Software, sondern auch die Zuverlässigkeit der verwendeten Sensoren und Drohnen. Da es zudem derzeit keine klare Gesetzgebung für den Einsatz von Drohnen in städtischen Gebieten gibt, bleibt die Integration dieser Technologie eine Herausforderung.
Zukunftsaussichten
Trotz der Hindernisse bleiben Flammini und sein Team optimistisch. Sie glauben, dass ihre Arbeit die Autonomie von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern wird. Zugleich betont Kuipers, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Integration des Menschen als Entscheidungsträger liegt: Der Roboter soll dem Menschen dienen, nicht umgekehrt.
Mit dieser Technologie stehen Wissenschaft und Gesellschaft an einem Wendepunkt, an dem das Zusammenspiel von KI und menschlichem Bedarf das Leben von Millionen Menschen positiv verändern könnte – vorausgesetzt, die ethischen und rechtlichen Fragen werden zufriedenstellend gelöst.