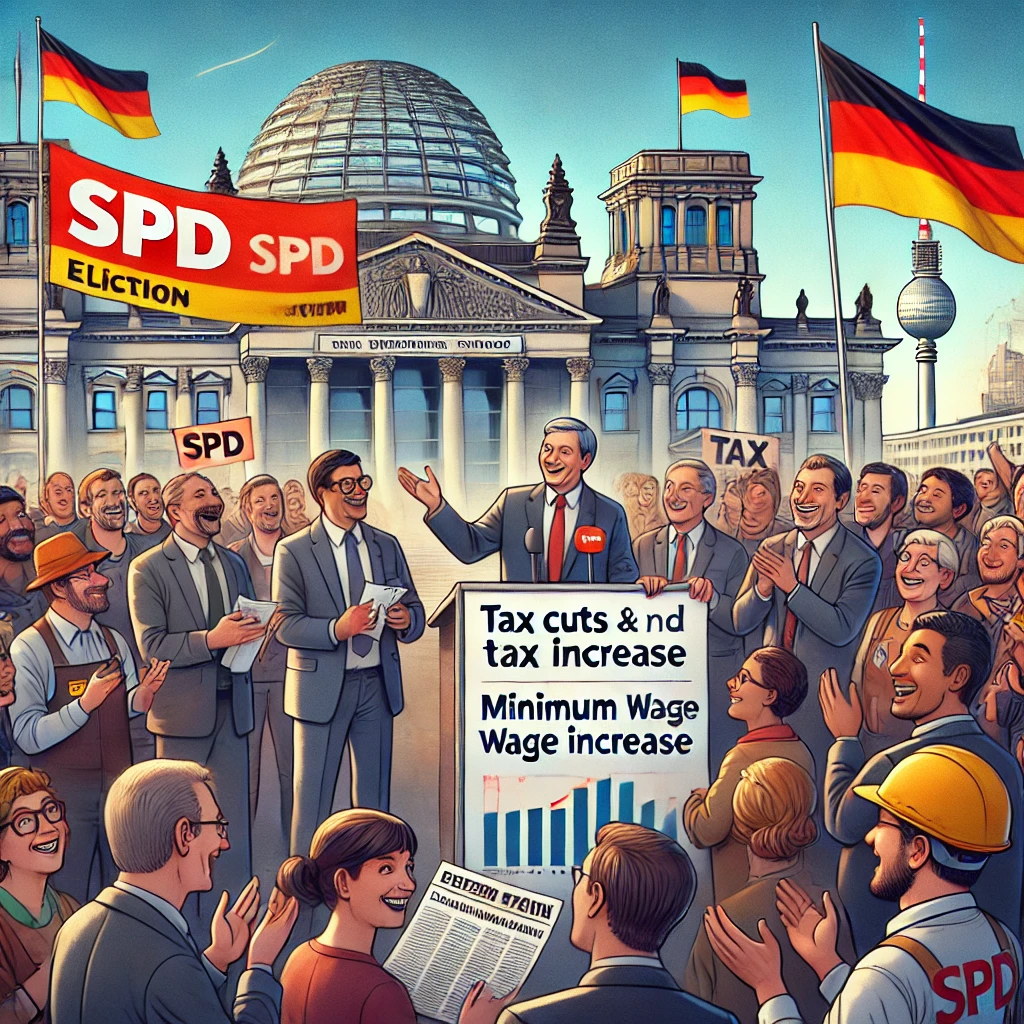Die neue bonify-App verspricht ihren Nutzer*innen einen kostenlosen Einblick in den eigenen Schufa-Eintrag und bietet Unterstützung, um die eigene Kreditwürdigkeit zu verbessern. Hinter der App steht jedoch die Schufa selbst, das Unternehmen, das maßgeblich über die Bonität von Menschen in Deutschland entscheidet. Die folgende Analyse beleuchtet, was die App bietet, wem sie wirklich nützt und warum diese Entwicklung kritisch zu betrachten ist.
Was ist bonify?
Die App bonify wurde ursprünglich 2015 von der Forteil GmbH in Berlin gegründet und 2019 als Kontoinformationsdienst zugelassen. Ende 2022 übernahm die Schufa das Berliner Fintech-Unternehmen und integrierte es in ihr Angebot. Laut den Angaben des Unternehmens nutzen mittlerweile rund 1,5 Millionen Menschen die App. bonify soll Nutzer*innen einen Überblick über ihre finanzielle Situation bieten, indem Kontodaten analysiert und in Kombination mit dem Schufa-Score ausgewertet werden. Dabei vermittelt bonify auch Finanzprodukte und erhält dafür eine Provision. Somit agiert die App auch als Makler für Finanzdienstleistungen.
Welche Informationen bietet die bonify-App?
Die bonify-App wirbt damit, dass Nutzerinnen ihren Schufa-Basisscore kostenlos und online überprüfen können. Darüber hinaus informiert sie über Veränderungen des Scores und verspricht, Tipps zur Verbesserung der Bonität zu geben. Diese Funktion ist jedoch nicht neu: Auch ohne die App können Verbraucherinnen mindestens einmal jährlich eine kostenfreie Schufa-Auskunft anfordern. Zudem ist eine Abfrage des Basisscores jederzeit bei der Schufa möglich, wenn sich die Daten beispielsweise durch neue Kredite, beglichene Verbindlichkeiten oder Einträge in öffentliche Schuldnerverzeichnisse ändern. Die Schufa aktualisiert diese Daten in der Regel alle drei Monate.
Kann bonify den Basisscore wirklich verbessern?
Die Werbung der bonify-App suggeriert, dass sie Nutzerinnen aktiv bei der Verbesserung ihres Scores unterstützt. In der Praxis erfahren Nutzerinnen jedoch vor allem, wie hoch ihr aktueller Score ist. Wenn fehlerhafte Einträge in der Schufa-Datenbank entdeckt werden, müssen die Nutzer*innen selbst aktiv werden und diese korrigieren lassen. Hier bietet bonify lediglich die Möglichkeit, über die App Kontakt zu den entsprechenden Auskunfteien aufzunehmen, behebt aber keine Einträge direkt.
Wem nützt die App wirklich?
Der Hauptnutzen der App liegt derzeit bei bonify selbst: Nutzer*innen sollen der App Zugang zu sensiblen Daten wie Kontoinformationen, Kreditkartendaten und Kontobewegungen der letzten 90 Tage gewähren. Diese Daten werden genutzt, um personalisierte Angebote für Finanzprodukte zu erstellen. bonify übermittelt diese Informationen auch an Partnerunternehmen, um passgenaue Finanzprodukte anzubieten. Bei erfolgreicher Vermittlung eines Kreditvertrags oder anderer Finanzprodukte erhält bonify eine Provision.
Für Verbraucher*innen bedeutet dies, dass die App vorrangig darauf abzielt, Produkte zu verkaufen, anstatt umfassend und kostenlos zu informieren. Die Schufa-Daten bleiben auch nach Nutzung der App entscheidend, wenn es darum geht, Kredite oder andere finanzielle Dienstleistungen zu erhalten.
Unsere Kritik: Datenschutz und Transparenz in Frage
Besonders kritisch sehen wir die datenschutzrechtlichen Aspekte der App. Die Schufa sammelt und verarbeitet umfangreiche Daten über die finanzielle Lage der Menschen und wertet diese nach Algorithmen aus, deren Details für die Nutzerinnen nicht nachvollziehbar sind. Dies war schon in der Vergangenheit ein Kritikpunkt, da es für Verbraucherinnen intransparent bleibt, wie die Schufa den Bonitätsscore berechnet.
Mit der bonify-App erschließt sich die Schufa nun zusätzlich ein Geschäftsfeld im Bereich der Finanzprodukte. Diese Verknüpfung zwischen der bisherigen Scoringtätigkeit und der Vermittlung von Finanzprodukten birgt Risiken. Ein großes Problem könnte darin liegen, dass Personen mit einem niedrigen Schufa-Score gezielt an bonify weitergeleitet werden und dort zwar Kredite erhalten können, diese jedoch oft zu schlechteren Konditionen als Menschen mit besseren Scores.
Hinzu kommt die Gefahr, dass die Schufa und bonify künftig noch enger zusammenarbeiten könnten. Obwohl derzeit kein Datenaustausch zwischen den beiden Unternehmen stattfindet, lässt sich eine solche Entwicklung für die Zukunft nicht ausschließen. Angesichts der unklaren Methoden zur Score-Berechnung ist es ratsam, der Schufa und ihren Tochterunternehmen keine zusätzlichen Daten zur Verfügung zu stellen, die für den Scoringprozess verwendet werden könnten.
Fazit: Vorsicht bei sensiblen Daten
Die bonify-App bietet Nutzerinnen eine einfache Möglichkeit, den eigenen Schufa-Score zu überprüfen, doch die Nutzung der App ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die umfassende Datensammlung und die Intransparenz der Schufa-Algorithmen werfen Fragen auf, die bisher nicht zufriedenstellend beantwortet wurden. Nutzerinnen sollten sich bewusst sein, dass sie bei der Verwendung der App sensible Finanzdaten preisgeben, die nicht nur zur Information, sondern vor allem zur Vermarktung von Finanzprodukten genutzt werden könnten. Daher sollte gut abgewogen werden, ob der Einblick in den Schufa-Score über die App die potenziellen Risiken wert ist.