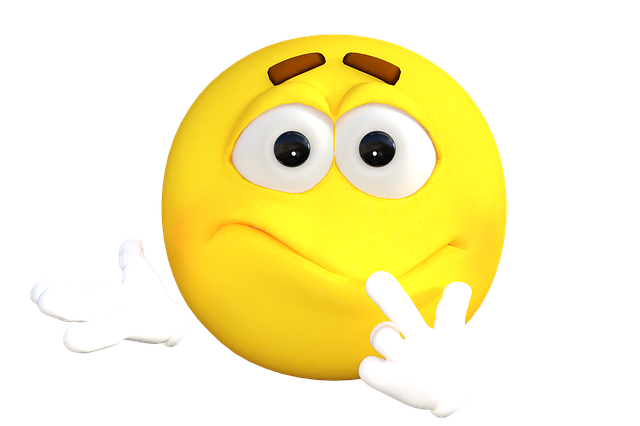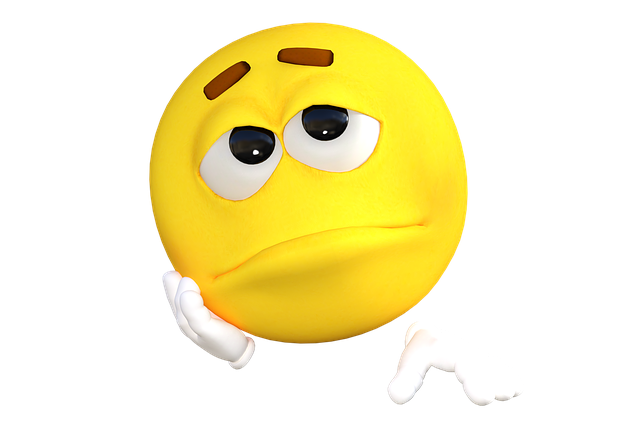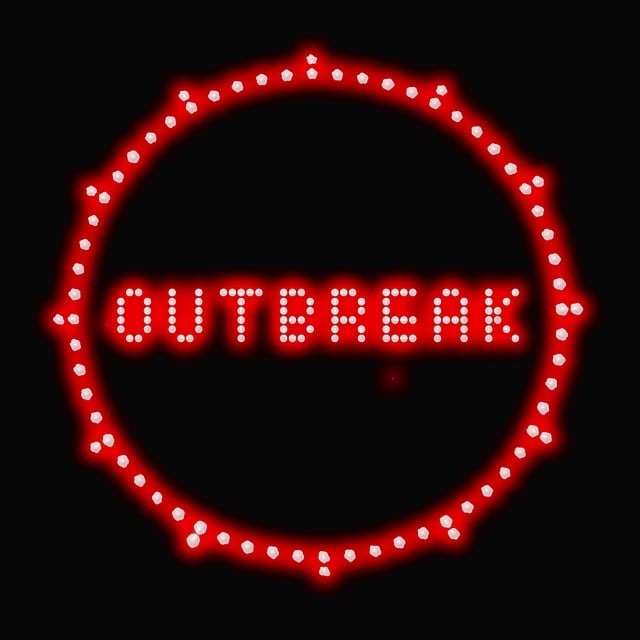Interviewer: Herr Reime, immer wieder wird die Frage gestellt: Ist die deutsche Innovationskraft in der Krise? Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
Jens Reime: Nun, das Thema „Innovation“ in Deutschland ist natürlich vielschichtig. Einerseits gibt es weiterhin großartige Erfindungen und Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Ingenieurskunst und in spezialisierten Branchen wie Maschinenbau oder Automobiltechnik. Doch andererseits muss man zugeben, dass die Geschwindigkeit der Innovation in einigen Bereichen nicht mehr mit der international vorgelegten Dynamik Schritt hält. Es scheint, als ob die deutschen Unternehmen oftmals in der Bürokratie feststecken oder zu stark auf bewährte Erfolgsrezepte vertrauen, anstatt neue, radikalere Ideen zu fördern.
Interviewer: Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist es wirklich die Bürokratie, die Innovation bremst?
Jens Reime: Die Bürokratie ist sicherlich ein Faktor, ja. In Deutschland gibt es eine starke Regulierungsstruktur, die zwar für Sicherheit und Verlässlichkeit sorgt, aber eben auch Prozesse verlangsamen kann. Insbesondere Start-ups und junge Unternehmen haben oft das Gefühl, gegen eine Flut von Vorschriften anzukämpfen. Und wer sich dann noch mit langen Genehmigungsverfahren herumschlagen muss, verliert vielleicht die Dynamik, die für Innovation so wichtig ist. Hinzu kommt oft eine gewisse Risikoaversion, die gerade bei Großunternehmen weit verbreitet ist. Man verlässt sich lieber auf Bewährtes, als mutig Neuland zu betreten.
Interviewer: Würden Sie also sagen, dass es an einer Kultur des Scheiterns mangelt, die in anderen Ländern wie den USA stark ausgeprägt ist?
Jens Reime: Absolut. In Deutschland wird Scheitern immer noch als Makel betrachtet, etwas, das man um jeden Preis vermeiden sollte. In Ländern wie den USA ist Scheitern ein Lernprozess, ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Diese Mentalität führt dazu, dass man dort schneller bereit ist, radikalere Ideen auszuprobieren, auch wenn das Risiko hoch ist. Hierzulande ist das Scheitern oft das Ende eines Projekts, statt der Anfang eines neuen Lernprozesses. Diese Kultur hemmt die Bereitschaft, wirklich disruptive Innovationen anzugehen.
Interviewer: Gibt es denn auch positive Entwicklungen, die Hoffnung geben?
Jens Reime: Natürlich. Besonders in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Umwelttechnologien und Mobilität gibt es vielversprechende Ansätze. Die Energiewende zum Beispiel ist ein Bereich, in dem Deutschland durchaus eine Vorreiterrolle einnimmt. Auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, gibt es viele Innovationen, die das Potenzial haben, die Branche nachhaltig zu verändern. Zudem haben wir hier in Deutschland eine hervorragende Forschungslandschaft mit Universitäten und Instituten, die an der Spitze technologischer Entwicklungen stehen. Das Problem ist oft, dass die Brücke zwischen Forschung und marktfähiger Innovation nicht immer reibungslos funktioniert.
Interviewer: Was müsste sich also ändern, damit Deutschland wieder zur Innovationsspitze aufschließt?
Jens Reime: Es braucht mehr Mut zu radikaleren Ideen und eine stärkere Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft. Zudem müssten Förderprogramme unbürokratischer gestaltet werden, damit neue Projekte schneller umgesetzt werden können. Auch die politische Unterstützung für Start-ups und kleine Unternehmen müsste ausgeweitet werden. Das Wichtigste aber ist ein Mentalitätswandel: Wir müssen lernen, Scheitern als Teil des Innovationsprozesses zu akzeptieren und uns von der Idee lösen, dass jede neue Idee sofort perfekt sein muss.
Interviewer: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Reime.